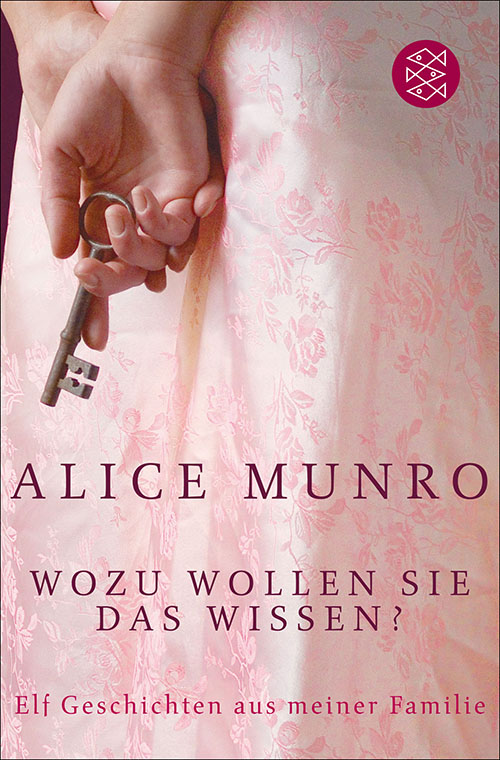![Wozu wollen Sie das wissen?]()
Wozu wollen Sie das wissen?
aber das Gras dort hat einiges von seinem Nährwert eingebüßt – es hat mehrmals Frost gegeben, also brauchen sie dazu noch das Heu.
Im Auto sitze ich neben ihm und halte die Konservendose, und wir nehmen langsam den alten, üblichen Weg – Spencer Street, Church Street, Wexford Street, Ladysmith Street – zum Krankenhaus. Die Stadt ist, anders als das Haus, so geblieben, wie sie war – niemand renoviert oder verändert sie. Trotzdem hat sie sich für mich verändert. Ich habe über sie geschrieben und sie verbraucht. Hier finden sich zwar immer noch mehr oder weniger dieselben Banken, dieselben Geschäfte für Haushaltswaren und Lebensmittel, auch der Friseur und der Rathausturm, aber all ihre geheimen, vielfältigen Botschaften an mich sind verdunstet.
Nicht so für meinen Vater. Er hat nur hier gelebt, nirgendwo sonst. Er hat sich von all dem hier nicht durch solche Benutzung losgemacht.
Zwei etwas seltsame Dinge passieren, als ich meinen Vater ins Krankenhaus bringe. Ich werde gefragt, wie alt er ist, und ich sage sofort: »Zweiundfünfzig«, was das Alter des Mannes ist, in den ich verliebt bin. Dann lache ich und entschuldige mich und laufe zu dem Bett in der Notaufnahme, wo er liegt, und frage ihn, ob er zweiundsiebzig oder dreiundsiebzig ist. Er schaut mich an, als bringe die Frage auch ihn in Verwirrung. Er fragt höflich: »Wie bitte?«, um Zeit zu gewinnen, dann kann er es mir sagen, zweiundsiebzig. Er zittert am ganzen Körper ein wenig, aber sein Kinn zittert auffällig, genau wie früher das meiner Mutter. In der kurzen Zeit seit seiner Ankunft im Krankenhaus hat eine Abdankung stattgefunden. Er wusste natürlich, was ihm bevorstand – weshalb er es hinausgeschoben hat. Die Schwester kommt, um seinen Blutdruck zu messen, und er versucht, seinen Hemdärmel aufzurollen, aber er schafft es nicht – sie muss es für ihn tun.
»Sie können im Raum draußen Platz nehmen«, sagt die Schwester zu mir. »Da ist es gemütlicher.«
Und als Zweites: Wie es der Zufall will, ist Dr. Parakulam, der Arzt meines Vaters – in der Stadt bekannt als der Hindu-Doktor – der Dienst habende Arzt in der Notaufnahme. Es dauert eine Weile, bis er eintrifft, und ich höre, wie mein Vater sich anstrengt, um ihn auf gewohnte, umgängliche Art zu begrüßen. Ich höre, wie die Vorhänge um das Bett zugezogen werden. Nach der Untersuchung kommt Dr. Parakulam heraus und wendet sich an die Schwester, die jetzt in dem Raum, in dem ich warte, Dienst tut.
»So. Nehmen Sie ihn auf. In den ersten Stock.«
Er setzt sich mir gegenüber, während die Schwester den Hörer abnimmt und wählt.
»Nein?«, sagt sie in den Hörer. »Aber er will ihn dahin haben. Nein. Gut, ich sag’s ihm.«
»Die meinen, er muss in die Drei-C. Kein Bett frei.«
»Ich will ihn nicht auf der Chronischen. Ich will ihn im ersten Stock.«
»Vielleicht reden
Sie
mal mit denen«, sagt sie. »Möchten Sie?«
Sie ist eine schlanke, hochgewachsene Schwester, trotz ihrer mittleren Jahre ein wenig burschikos, fröhlich und salopp. Ihr Ton ihm gegenüber ist weniger taktvoll, weniger korrekt und ehrerbietig als der Ton, den ich von einer Schwester einem Arzt gegenüber erwarten würde. Vielleicht ist er kein Arzt, der sich Respekt verschafft. Oder vielleicht liegt es einfach daran, dass Frauen vom Lande und aus Kleinstädten, deren Ansichten im Allgemeinen recht konservativ sind, in ihrem Benehmen oft ruppig und respektlos sein können.
Dr. Parakulam greift zum Hörer.
»Ich will ihn nicht in der Chronischen haben. Ich will ihn im ersten Stock. Na, können Sie nicht … Ja, ich weiß. Aber geht es nicht trotzdem? … Dieser Fall … Ich weiß. Aber ich sage … Ja. Ja, gut. Gut. Verstehe.«
Er legt den Hörer auf und sagt zu der Schwester: »Lassen Sie ihn auf die Drei bringen.« Sie nimmt den Hörer, um das zu veranlassen.
»Aber Sie wollen ihn doch auf der Intensivstation haben«, sage ich, weil ich denke, dass es einen Weg geben muss, die Bedürfnisse meines Vaters durchzusetzen.
»Ja. Da hätte ich ihn gern, aber ich kann nichts weiter tun.« Zum ersten Mal sieht mir der Arzt in die Augen, aber jetzt bin ich es, die vielleicht seine Feindin ist, nicht mehr die Person am Telefon. Ein kleiner, brauner, eleganter Mann ist er, mit großen, glänzenden Augen.
»Ich habe mein Bestes getan«, sagt er. »Was meinen Sie, was ich noch tun kann? Was ist ein Arzt? Ein Arzt ist nichts mehr.«
Ich weiß nicht, wem er die Schuld daran
Weitere Kostenlose Bücher