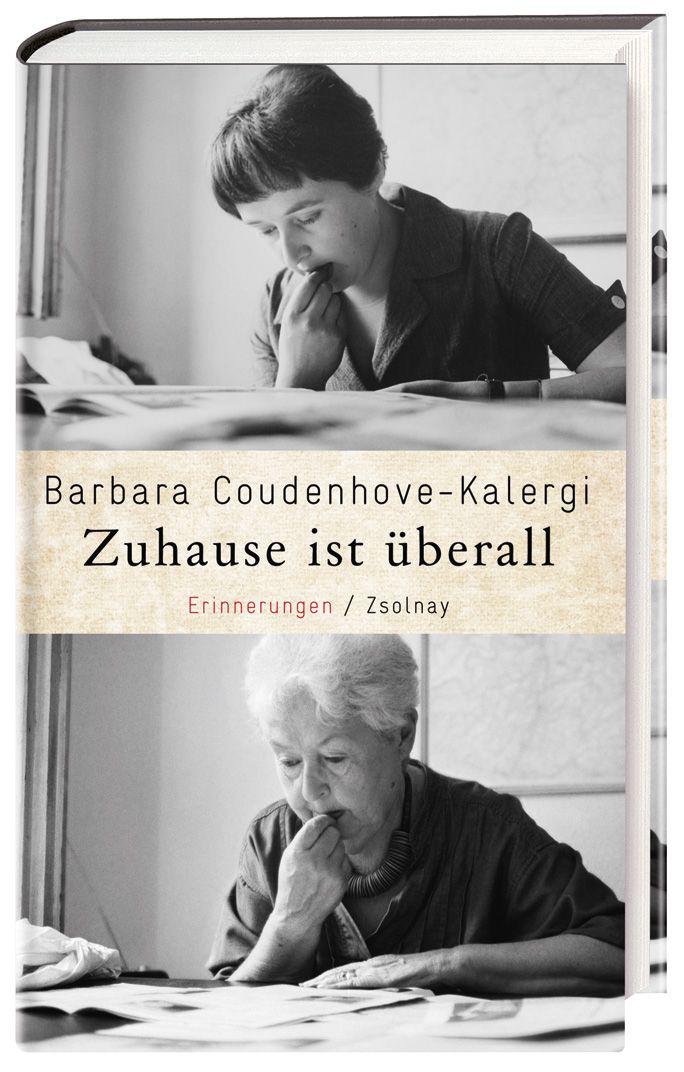![Zuhause ist ueberall]()
Zuhause ist ueberall
nicht«, beschied er einem sich nach Naziart als gottgläubig bezeichnenden Neuankömmling. Zum Abschied veranstaltete er für meinen entlassenen Vater ein großes Abendessen im Kameradenkreis.
In den Briefen meines Vaters an meine Mutter und auch in seinen nachgelassenen Erinnerungen ist viel von der Schönheit der Kaukasus-Landschaft die Rede, von der archaischen Herzlichkeit der Menschen dort, die die Deutschen zunächst als Befreier willkommen geheißen hatten, und von den preußischen Kameraden, unter denen er gute Freunde gefunden hatte. Über die Gräueltaten der Eindringlinge, der SS wie der Wehrmacht, liest man nichts. Gewusst hat unser Vater davon allerdings schon. Während eines Urlaubs erzählte er meiner Mutter, wie ich später erfuhr, unter vier Augen und unter dem Siegel der Verschwiegenheit von der Ermordung von Juden mittels der berüchtigten mobilen Gaskammern. Davon hatte er aus sicherer Quelle gehört. Trieb es ihn um? Bewog es ihn zum Zweifeln an seiner eigenen Rolle in der Besatzerarmee? Als Dolmetscher hatte er auch die Aufgabe, bei den Verhören russischer Gefangener mitzuwirken. Wie ging es ihm dabei? War er ehrlich überzeugt von dem später oft wiederholten Stehsatz »Die Wehrmacht ist sauber«? Ich weiß es nicht. Mit mir sprach er darüber nie. Und ich habe nie gewagt, ihn danach zu fragen.
Auch mein Bruder Hans Heinrich bekommt die Sippenhaftung zu spüren. Er ist in einer Offiziersschule in Deutschland und wird nach dem entsprechenden Erlass sofort an die Ostfront expediert, nicht als Fahnenjunker, sondern als gewöhnlicher Soldat. Auch ihm sagen seine Vorgesetzten, dass sie die Maßnahme bedauern. Hans Heinrich scheint die Degradierung nicht allzu viel auszumachen, er kommt auf dem Weg nach Osten über Weihnachten nach Hause und zeigt sich vergnügt und zuversichtlich. Um zehn Uhr abends soll er am Bahnhof sein, aber er weiß aus Erfahrung, dass der Zug sicher erst sehr viel später abfahren wird. Während wir alle gespannt zuhören, ruft er den Transportverantwortlichen an und meldet sich frech mit dem Namen seines Regimentskommandeurs. »Hier Major Dünsch«, sagt der achtzehnjährige Nobody mit Autoritätsstimme, bekommt seine Auskunft – ja, es ist noch Zeit genug, Abfahrt ist erst um Mitternacht – und wünscht leutselig: »Na, dann frohe Weihnachten noch.« Ich komme wieder einmal aus der Bewunderung nicht heraus.
Die Schrecken des Krieges – habe ich als Kind etwas davon mitbekommen? Den Holocaust, das Massensterben an den Fronten, die Zerbombung der Städte? Kaum. Mir fehlt es nicht an Phantasie, aber ich sehe keine Bilder von Leid und Elend, die sich mir einprägen. In der Deutschen Wochenschau, die man im Kino sieht, kommen immer die gleichen Aufnahmen: Flugzeuge, die über den Himmel preschen und Bomben abwerfen. Kleine Rauchwölkchen weit unten am Boden. Soldaten, die Geschütze bedienen, Granaten ins Rohr schieben, nachher hört man den Krach. Soldaten, denen Orden verliehen werden, sie sehen ernst und stolz aus. Militärtransporte, die über Straßen rollen. Das Äußerste sind Bilder von Verwundeten mit dem Arm in der Schlinge, sie werden von hübschen Rotkreuzschwestern versorgt.
Wir bekommen den Krieg in bekömmlichen Häppchen serviert, wir hören von Siegen und Heldentaten, später von geordneten Rückzügen. Das Grauen bleibt draußen. Für uns Kinder ist der Krieg Alltag, die Kulisse für ein mehr oder minder normales Leben. Abends beten wir routinemäßig: »Lieber Gott, gib uns den Frieden.« Aber wie dieser Frieden aussehen soll, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. »Nach dem Krieg« ist so irreal wie »in hundert Jahren«.
Ist zu Hause davon die Rede, was sein wird, wenn die Deutschen den Krieg verlieren? Spätestens nach Stalingrad gibt es nicht mehr viele Zweifel daran. Als Hans Heinrich in den Krieg zieht, ist die Ostfront schon in Schlesien. Es geht eigentlich nur noch darum, ob Prag von den Russen oder von den Amerikanern erobert wird, die sich von Osten und von Westen her der tschechoslowakischen Hauptstadt nähern. Alle hoffen auf die Amerikaner. Viele Reichsdeutsche haben die Stadt verlassen. Wir sind inzwischen, weil Papi ja nun wieder zu Hause ist, von Breznitz in die Bud’ánka zurückgekehrt. Eine Tante, die auf dem Land lebt, schreibt uns auf einer Postkarte: »Wenn der Bolschewikus kommt, könnt Ihr bei mir im Gärtnerhaus wohnen.« Aber wir bleiben in Prag. Und warten auf den Bolschewikus.
Die Vertreibung
Am 5. Mai 1945
Weitere Kostenlose Bücher