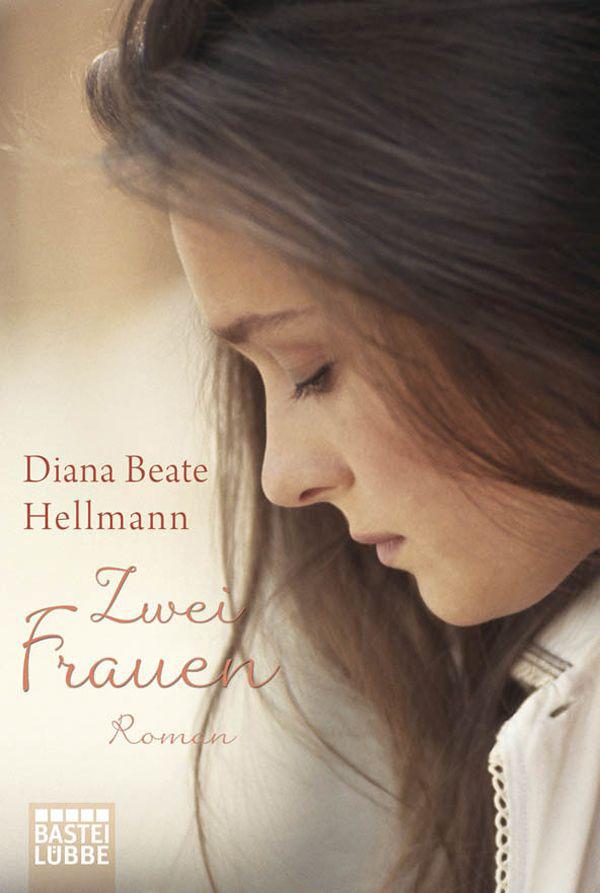![Zwei Frauen: Roman (German Edition)]()
Zwei Frauen: Roman (German Edition)
verlassen!
Wieder saß ich stundenlang rauchend auf meinem Bett, und wieder malte ich bizarre Muster auf die Fensterscheibe, wieder lief ich im Zimmer auf und ab wie ein konditionsbesessener Strafgefangener, um dann endlich an einem schwülen Julitag auf zwei andere Worte zu stoßen: Alte Leute! Das war sie, die Lösung.
Das Phänomen des Alters hatte mich schon in meiner Kindheit fasziniert. Alte Leute, die ihr Leben mehr oder weniger gelebt hatten, kurz vor dem Ende standen und deshalb gern die »armen Alten« genannt wurden, sie wirkten allesamt so sehr viel reicher als die Jungen, die noch alles vor sich hatten und deshalb glaubten, »reich« zu sein.
Warum das wohl so war, kam mir erst jetzt in den Sinn. Alte Menschen hatten vieles verloren: Verwandte, Freunde, manchmal auch den Partner. Sie waren an diesen Verlusten aber nicht zerbrochen, sondern sie schienen sich selbst um das Verlorene bereichert zu haben. Folglich musste es möglich sein, den Verstorbenen »weiterzuleben«, es musste möglich sein!
Als ich mir das erst mal in den Kopf gesetzt hatte, führte auch schon kein Weg mehr daran vorbei, es auszuprobieren. Ich versuchte gezielt, mich zu erinnern, wie Claudia ausgesehen und sich bewegt hatte, wie sie gesprochen, gelacht und geweint hatte. Ich erinnerte mich an Dinge, die Claudia und ich gemeinsam erlebt hatten, an Dinge, die sie mir mal erzählt hatte. Das meiste davon schrieb ich auf, wie ich auch ein Büchlein anlegte, das ich »Gesammelte Flüche« nannte. Bald versuchte ich, Udos Liedern etwas abzugewinnen, indem ich sie in jeder freien Minute hörte, und bei allem, was geschah, fragte ich mich, was Claudia wohl dazu gesagt hätte, wie sie reagiert hätte, was ich wohl tun müsste, um das zu tun, was sie getan hätte. Zu Anfang war das nicht viel mehr als eine Aufgabe, die Leere und Trübsinn verbannte, weil sie mich forderte. Mit der Zeit wurde es aber mehr als das. Ich stellte fest, dass ich Claudia gar nicht in mir zu suchen, sondern einfach nur herauszulassen brauchte. Sie war nämlich schon seit langem da.
Tief in mir gab es eine Eva namens Claudia, eine Eva, die schimpfte und fluchte, eine Eva, die fast ebenso laut und mitreißend »brüllte«, wie Claudia es immer getan hatte, eine Eva, der Udo Jürgens und seine Lieder immer besser gefielen, eine Eva, die Komödie und Tragödie zu einer Einheit verschmelzen ließ. Die Eva, die ich einmal gewesen war, hatte die große Tragödin gespielt, eine Figur, über die man nicht nur lachen konnte, sondern sogar lachen musste. Claudia war der Ausgleich gewesen, die Komödiantin, ein Clown, der jeden zum Weinen brachte. Die Eva, die ich jetzt war, durfte beides in einem sein. Claudia hatte mir ihren Teil zurückgelassen. So war das Mädchen Claudia Jacoby nicht für alle Zeiten von mir gegangen, wie ich in ihrer Todesstunde geglaubt hatte, sondern sie war von mir gegangen, um für alle Zeiten zu mir zu kommen. Sie half mir, aus einem Labyrinth von Ängsten, dessen Ausgänge bewacht wurden von Schuldgefühl und Schmerz, den Weg in eine neue Lebensfreude zu finden. Niemals sollte ich Claudia vergessen, und ich sollte auch noch so manche Träne um sie weinen. Doch was sie mir gegeben hatte, sollte in mir weiterleben, ein Leben lang …
Es dauerte bis zum 1. August, bis Willi Schultheiß, Claudias Verlobter, sich blicken ließ.
Ich gab ihm Claudias Abschiedsbrief. Er konnte ihn nicht selbst lesen, so schwach fühlte er sich, so feige schien er. So musste ich Claudias Brief vorlesen. Er bestand nur aus der Anrede: »Lieber Willi!« Darunter hatte sie ein Gedicht von Ferdinand Freiligrath gesetzt. Es begann mit den Worten: »O lieb, solang du lieben kannst.«
KAPITEL 28
Im Vorfeld war viel darüber geredet worden.
»Wer die Chemotherapie übersteht«, hatte es immer geheißen, »der macht die Bestrahlungen mit links!«
So war ich wahrhaft frohen Mutes, als Schwester Helma mich und mein Bett am Morgen des 25. August 1977 im Zimmer abholte.
»Auf in die Isotopen!«, rief ich, als ginge es darum, sich von einer Höhensonne gesunde Urlaubsbräune verpassen zu lassen. Genauso verhielt ich mich auch. Auf dem Weg zum Aufzug zog ich dem vorübereilenden Doktor Behringer kichernd das Stethoskop aus der Kitteltasche, im Aufzug plapperte ich munter vor mich hin, und als Helma sich von mir verabschiedete, galt meine einzige Sorge dem Tschaikowsky-Konzert, das zur Stunde vom Radio übertragen wurde und das Schwester Gertrud für mich aufzeichnen
Weitere Kostenlose Bücher