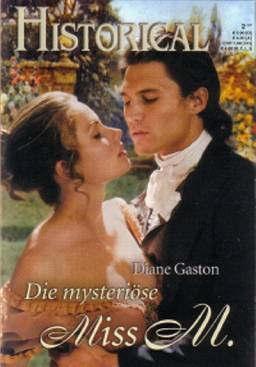![223 - Gaston, Diana - Die mysteriöse Miss M]()
223 - Gaston, Diana - Die mysteriöse Miss M
Marquess und die Marchioness, die beieinanderstanden und mit hochrotem Kopf in ihre Richtung blickten.
„Dev“, sagte Ned und kam ihm entgegen. „Schön, dich zu sehen.“
Devlin wunderte sich immer noch über den herzlichen Händedruck und die freundliche Begrüßung, als er ihnen Ram vorstellte.
„Ich habe Lord Ramsford bereits einige Male gesehen“, sagte Serena. „Es freut mich, Sie kennenzulernen. Als ein Freund von Devlin sind Sie sehr willkommen.“
Ned schickte Barclay für Getränke in die Küche und bat Devlin, mit ihm unter vier Augen reden zu können.
Sie gingen in die Bibliothek, wo Devlin unwillkürlich an jene handgreifliche Auseinandersetzung mit seinem Bruder denken musste, die sich in diesem Raum abgespielt hatte.
„Verzeih mir, wenn ich mich nicht um deinen Freund kümmere, aber ich muss mit dir reden. Serena und ich reisen morgen nach Heronvale. Ich habe dort … etwas Geschäftliches zu erledigen, und sie wird mich begleiten.“
Warum machte Ned sich die Mühe, ihm seine Pläne zu erklären? Und warum war er so rot im Gesicht?
Ned deutete auf einen der Ledersessel, Devlin nahm Platz und bekam von seinem Bruder ein kleines Glas Sherry gereicht.
„Ich hoffe, es ist alles in Ordnung“, sagte er.
„Ja … ja, alles in Ordnung. In bester Ordnung.“ Ned wich seinem Blick aus, doch Devlin glaubte, seinen Bruder bei diesen Worten grinsen zu sehen.
„Ich bezweifle, dass wir vor dem Ende der Saison zurückkehren werden“, fuhr Ned fort und nahm ebenfalls Platz. „Ich wollte mit dir über deine … deine Fortschritte sprechen, um es einmal so auszudrücken.“
Neds Tonfall und Auftreten konnte man wohl als entgegenkommend bezeichnen, es änderte jedoch nichts daran, dass er Devlins Zukunft fest im Griff hatte.
„Ich habe mich noch nicht verbindlich geäußert“, antwortete Devlin und versuchte, sachlich zu klingen.
„Die Saison ist in wenigen Wochen vorüber.“ Auf einmal wirkte Ned verkrampft.
„Aber ich habe mich entschieden“, fügte Devlin mit einem resignierten Seufzer an.
„Und wer ist die Dame?“
„Miss Emily Duprey.“ Ihm war, als würde eine Käfigtür zufallen. Ihren Namen laut auszusprechen machte es so schrecklich endgültig.
„Tatsächlich?“, erwiderte sein Bruder überrascht. „Ich dachte, du seist an Miss Reynolds interessiert.“
Devlin warf ihm einen zornigen Blick zu. „ Interessiert bin ich an Miss Duprey auch nicht.“
Zumindest war Ned so entgegenkommend, dass er beschämt wirkte.
„Miss Reynolds und mich verbindet eine sonderbare Freundschaft“, sagte Devlin nach einem weiteren Schluck Sherry. „Keiner von uns hegt die Absicht einer Bindung.“
„Über die Dupreys weiß ich nicht allzu viel. Ist Malvern ihr Gut? Eine Baronie?“
„Ja.“ Es war eine angemessene Verbindung, Ned sollte seine Zustimmung geben.
„Nun denn …“ Sein Bruder hielt inne und fragte sanfter als zuvor: „Hast du Miss England und das Kind untergebracht?“
Ja, Bruder, treib die Klinge ruhig noch tiefer in mein Herz, dachte Devlin. „Noch nicht.“
Ned stand auf, ging zum Schreibtisch und schrieb etwas auf. Dann kam er zurück zu Devlin und gab ihm ein Blatt Papier. „Damit kannst du während meiner Abwesenheit Geld abheben. Du wirst zusätzliche Mittel für die Unterbringung deiner … deiner Schützlinge benötigen. Sie müssen ein anständiges Zuhause haben, vielleicht in Chelsea.“
Devlin nahm das Papier an sich und konterte in kühlem Tonfall: „Ich hielt eigentlich etwas auf dem Land für die bessere Lösung.“
„Es wäre von Vorteil für sie, von Angehörigen der Mittelschicht umgeben zu sein“, erklärte Ned beim Hinsetzen, als würden sie über irgendeinen leblosen Gegenstand diskutieren. „Du willst doch nicht, dass die Leute auf den Gedanken kommen, Fragen zu stellen. Eine ‚Witwe‘ mit ihrem Kind würde in Chelsea nicht auffallen.“
„Überhaupt nicht“, erwiderte Devlin, obwohl er Ned am liebsten erklärt hätte, dass Madeleine aufs Land ziehen sollte, damit sie ausreiten konnte, wenn ihr danach war. Noch viel lieber hätte er ihm gesagt, dass er ebenso gut seine eigene Seele zerstören konnte, wenn er gezwungen wurde, Madeleine und Linette wegzuschicken.
Sein Blick fiel auf die Zahlungsanweisung an seine Bank, und er musste stutzen. So großzügig hatte er seinen Bruder noch nicht erlebt.
„Wir wollen schließlich nicht, dass
Weitere Kostenlose Bücher