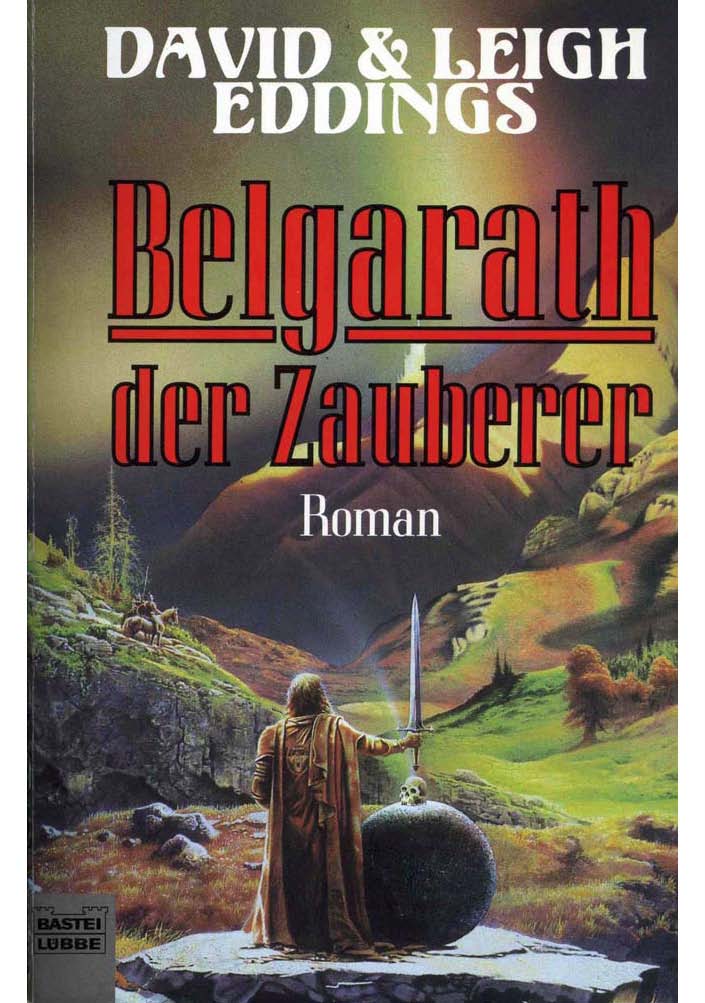![Belgarath der Zauberer]()
Belgarath der Zauberer
Seltsamerweise schien sich Beldaran an der Wortwahl ihrer Schwester nicht im geringsten zu stören. Sie wußte bestimmt, was die Worte bedeuteten, doch es schien ihr nichts auszumachen. Vielleicht teilte sie insgeheim die Meinung ihrer Schwester, hatte mir aber vergeben. Polgara war offensichtlich nicht dazu bereit.
Ich saß in Beldins Turmzimmer und blickte aus dem Fenster auf den Sonnenuntergang, während meine Tochter mit ihrer Schmährede fortfuhr. Nach einer Stunde etwa fing sie an, sich zu wiederholen. Es gibt in jeder Sprache eine gewisse Anzahl von Beleidigungen. Zwischendurch sprach sie gelegentlich Ulgo, was sie jedoch nicht allzu gut beherrschte. Ich verbesserte sie natürlich; es ist die Aufgabe des Vaters, die Kinder zu verbessern. Pol war darüber nicht begeistert.
Schließlich stand ich auf. »Das führt zu nichts«, sagte ich ihr. »Wir sollten jetzt alle nach Hause gehen. Sobald ich im Turm Ordnung geschaffen habe, könnt ihr Mädchen wieder zu mir ziehen.«
»Das kann doch nicht dein Ernst sein!«
»Sicher meine ich das ernst, Pol. Fang an zu packen. Ob es dir gefallt oder nicht, wir werden eine Familie sein.« Ich lächelte ihr zu. »Schlaf gut, Polgara.« Dann ging ich.
Ich konnte sie noch toben hören, als ich zu meinem Turm gelangte.
In der folgenden Woche zogen die Mädchen zu mir. Beldaran war eine artige Tochter und gehorchte, ohne zu fragen. Das zwang natürlich auch Pol zu einer gewissen Willfährigkeit; denn sie liebte ihre Schwester so sehr, daß sie es nicht ertragen konnte, von ihr getrennt zu sein. Wir bekamen sie nicht oft zu sehen, aber wenigstens waren ihre Sachen im Turm.
Die meiste Zeit des Spätsommers verbrachte sie in den Ästen des großen Baumes in der Mitte des Tals. Anfangs dachte ich, daß der Hunger sie nach Hause treiben würde, doch ich hatte die Angewohnheit der Zwillinge vergessen, jeden zu futtern, der in ihre Nähe kam. Sie sorgten dafür, daß Polgara nicht hungerte.
Ich beschloß, die Sache auszusitzen. Im Winter mußte Polgara schließlich nach Hause kommen. Das muß für meine blonde Tochter eine schwere Zeit gewesen sein. Sie liebte uns beide, und die Spannung zwischen uns mußte ihr große Sorgen bereitet haben. Sie bat mich, mit Polgara Frieden zu schließen. Ich wußte, daß dies ein Fehler war, aber ich konnte Beldaran keine Bitte abschlagen, also seufzte ich und ging ins Tal, um es noch einmal zu versuchen.
Es war ein warmer, sonniger Morgen im Spätsommer, und es schien mir, daß ungewöhnlich viele Vögel umherflogen, als ich mich durch das hohe Gras dem Baum näherte.
Als ich dort ankam, waren sogar noch mehr Vögel da. Rotkehlchen, Zaunkönige, Spatzen, Finken und Lerchen schwärmten um den Baum, und das Gezirpe und Gezwitschere war ohrenbetäubend.
Polgara lag lässig in der Gabel eines riesigen Astes etwa zwanzig Fuß über dem Boden und schaute mich mit kaltem, unfreundlichem Blick an. »Was willst du, Vater?« fragte sie, als ich am Baum angelangt war.
»Findest du nicht, daß das lange genug gedauert hat?«
»Was?«
»Daß du so kindisch bist.«
»Ich darf kindisch sein. Ich bin erst dreizehn. Wir werden noch viel mehr Spaß haben, wenn ich erwachsen bin.«
»Mit dieser Albernheit brichst du Beldaran das Herz. Sie vermißt dich sehr.«
»Sie ist stärker, als sie aussieht. Sie kann fast soviel ertragen wie ich.« Sie scheuchte eine trällernde Lerche von der Schulter. Die Vögel um sie sangen inbrünstig in ekstatischer Bewunderung.
Ich versuchte es auf andere Weise. »Du läßt dir eine gute Gelegenheit entgehen, Pol«, sagte ich ihr.
»Ach?«
»Du hast dir während des Sommers sicher neue Beschimpfungen einfallen lassen. Die kannst du mir nicht an den Kopf werfen, wenn du hier auf den Ästen sitzt und den Schnabel wetzt.«
»Dafür haben wir später noch Zeit. Im Augenblick wird es mir schlecht, wenn ich dich nur ansehe. Gib mir ein paar Dutzend Jahre, mich an dich zu gewöhnen.« Sie lächelte mir mit der Wärme eines Eisbergs zu. »Dann werden wir uns unterhalten. Ich habe dir sehr vieles zu sagen. Geh jetzt.«
Bis heute weiß ich nicht, wie sie es bewirkt hatte, doch der Gesang der Vögel klang plötzlich bedrohlich, und der Schwarm tauchte als dichte Wolke über mich herab. Sie hackten mit den Schnäbeln und schlugen mit den Flügeln nach mir. Ich versuchte sie zu vertreiben, doch es waren zu viele. Die Singvögel konnten mir nur ein paar Haare von Kopf und Bart auszupfen; die Falken aber machten mir schon mehr angst.
Weitere Kostenlose Bücher