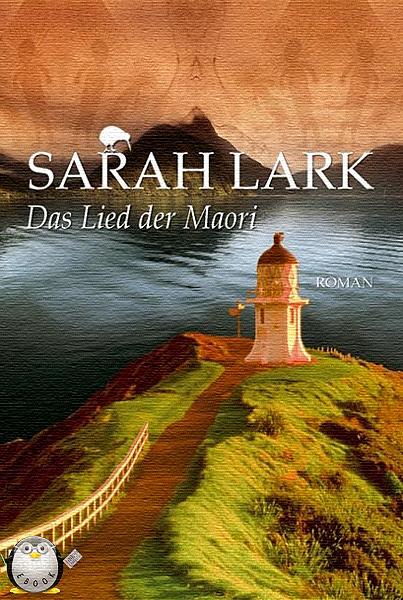![Das Lied der Maori]()
Das Lied der Maori
ich ›Miss Martyn‹ an der Orgel nicht das Wasser reichen kann ... wo sie sich schon dazu herablässt, das niedere Volk an ihrem engelhaften Spiel teilhaben zu lassen. Passen Sie aber bloß auf, dass Mrs. Tanner nicht wieder konsequent am Ton vorbeisingt. Dann kann ›Miss Martyn‹ ziemlich ungemütlich werden!«
Damit rauschte Elaine hinaus. Sie hatte nicht übel Lust, Kura zur Rede zu stellen, überlegte es sich dann aber anders. Kura würde ihren Ausbruch nur genießen und wahrscheinlich ein paar spitze Bemerkungen zum Orgelspiel ihrer Rivalin machen. Elaine wusste schließlich genau, dass sie nicht perfekt war. Kura würde die Trauerfeier sehr viel festlicher gestalten. Allein ihr Anblick wirkte belebend.
So ritt Lainie stattdessen zu den Leroys und besuchte Tim, wie inzwischen jeden Nachmittag. Sie wusste, dass man in der Stadt darüber redete – wobei die Leute zum Teil der Ansicht waren, sie erfülle damit nur eine Christenpflicht, während die anderen tuschelten, Miss Lainie wolle sich zweifellos den Sohn des reichen Minenbesitzers angeln. Der blieb ja auch als Krüppel eine gute Partie ...
Am gelassensten reagierten noch die Bergleute. Sie hatten Tim oft neben dem Klavier im Pub stehen sehen, und einige wussten auch von seiner beharrlichen, aber bislang vergeblichen Werbung. Jetzt fragten sie Lainie jeden Tag nach seinem Befinden.
Elaine ermutigte die Männer dann, Tim ebenfalls zu besuchen, was viele auch taten. Mrs. Leroys Rechnung ging auf. In dem kleinen Hospital war er zumindest nicht völlig abgeschlossen von der Welt, und die Besuche seiner Freunde heiterten ihn auf. Das war dringend nötig, auch wenn Tim es sich nicht anmerken ließ. Er wartete auf den Experten aus Christchurch, aber der schien viel zu tun zu haben. Dabei setzte Tim größte Hoffnungen in ihn.
Die vorläufige Diagnose Dr. Leroys war ihm inzwischen zu Ohren gekommen, obwohl Lainie – wie auch Mrs. Leroy – sich eher vage geäußert hatten und selbst der Doktor seine schlimmsten Prognosen für sich behielt. Tims Mutter jedoch kannte keine Zurückhaltung. Nellie Lambert besuchte ihren Sohn jeden Tag und schien es als ihre Pflicht anzusehen, dabei eine Stunde lang unausgesetzt zu weinen. Waren die sechzig Minuten um, verabschiedete sie sich rasch, wobei sie meist ungeschickt gegen sein Bett stieß. Tim versuchte, dies von der komischen Seite zu nehmen, doch es war nicht immer einfach, zumal er jedes Mal große Schmerzen litt, wenn er auch nur leicht bewegt wurde. Dann brauchte er oft Stunden, bevor die Messer, die durch seinen Körper schnitten, endlich innehielten. Mrs. Leroy wusste das genau, und da auch sie ihm bei der täglichen Pflege unweigerlich wehtat, bot sie ihm Morphium an. Doch Tim lehnte konsequent ab.
»Ich mag ja zerschlagene Beine haben, aber das ist schließlich kein Grund, mir auch noch den Kopf zu benebeln! Ich weiß, dass man irgendwann nicht mehr damit aufhören kann, Mrs. L., und das will ich nicht!«
Manchmal wurde es allerdings so schlimm, dass er seine ganze Kraft brauchte, um nicht zu schreien. Mrs. Leroy gab ihm dann Laudanum, während Lainie still neben ihm saß, einfach nur wartete oder vorsichtig seine Hand nahm. Ihre zarten, zögernden Berührungen konnte Tim noch am ehesten ertragen; sie fasste niemals fest zu. Selbst wenn sie ihm zu trinken gab oder ihm nach einem Schweißausbruch bei einer Schmerzattacke die Stirn trocknete, blieben ihre Bewegungen federleicht.
An diesem Tag war Tim gut gelaunt, zumal der Spezialist aus Christchurch sich nun endgültig für den Tag nach der Trauerfeier angesagt hatte. Tim freute sich darauf und lächelte über Lainies Wut auf Kura und den Reverend.
»Irgendwann werden Sie mir verraten müssen, was Sie gegen dieses Maori-Mädchen haben, das für Paddy Holloway Klavier spielt!«, neckte er sie, hörte aber gleich damit auf, als Elaines Miene sich versteinerte. Sie reagierte immer so, wenn er sie nach ihrer Vergangenheit fragte. »Sehen Sie es positiv, Lainie, Sie brauchen nicht zu dieser Trauerfeier zu gehen und zu weinen, sondern können stattdessen mir Gesellschaft leisten. Mrs. Leroy wird sich freuen. Die macht sich sowieso Sorgen, dass ich mich in Depressionen ergehe, wenn sie mich allein lässt. Andererseits kann sie als Arztfrau nicht wegbleiben. Sie war fast schon so weit, meine Mutter zu fragen, ob sie nicht bei mir bleiben wollte. Aber die lässt sich auf keinen Fall die Chance entgehen, gramgebeugt ihr neues schwarzes Spitzenkostüm vorzuführen.
Weitere Kostenlose Bücher