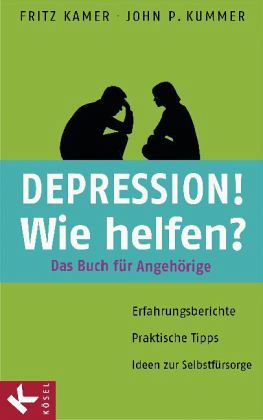![Depression! Wie helfen? - das Buch für Angehörige]()
Depression! Wie helfen? - das Buch für Angehörige
anführen möchte.
Danach ist nicht der Topmanager, der um zwei Uhr morgens noch lustvoll seine E-Mails durchgeht (und Aussicht auf einen Aufsichtsratssitz hat), am meisten gestresst, sondern der kleine Angestellte, der sich in seinem minderen sozialen Status nicht wohlfühlt, dort aber nicht herauskann.
Daraus können wir u. a. folgende Schlüsse ziehen:
Erstaunlich: Der Manager mit Burnout hat eigentlich weniger Stress als der mit seinen Karriereaussichten unzufriedene Angestellte, der sich keinen Burnout leisten kann (und in einer Erschöpfungsdepression Zuflucht nehmen muss).
Logisch: Der in seinem Statuskäfig gefangene kleine Angestellte ist von seinen (eventuell von ihm selbst herangezogenen) Aufgaben viel eher gestresst und damit anfällig für eine Depression. Wenn er dann nach seiner Rückkehr in die Firma eine weniger anspruchsvolle Aufgabe erhält, kann er sich als »The King« fühlen und der Stress ist weg.
Alarm vor dem Tor
In gewollter Redundanz wiederhole ich den Schlusssatz eines früheren Kapitels: Anzeichen, dass der Depressionsbetroffene mit der »ewigen Ruhe« liebäugelt, sind immer und in jedem Fall ernstzunehmen. Handeln Sie! Und zwar schleunigst.
Suizide können nicht ungeschehen gemacht werden. Suizidversuche können lebenslange körperliche Schäden nach sich ziehen – ganz abgesehen vom Schrecken und der Trauer der Angehörigen. Es versteht sich von selbst, dass die betreuende Fachperson sofort zu verständigen ist.
Wir haben gesehen, dass unser Patient oft nah am Tor zum Jenseits steht, dass Gevatter Tod ein häufiger, sogar als liebevoll empfundener Begleiter unseres Patienten ist. Der Umgang mit seiner Todessehnsucht fordert uns bis zum Letzten, die Hilfestellung auf diesem Gebiet ist der wohl schwierigste Teil unserer Aufgabe als Betreuer.
Praktisch jeder Depressionskranke beschäftigt sich mit Suizidgedanken, und es ist von Grund auf falsch, diesem – zugegebenermaßen – heiklen Problem aus dem Wege zu gehen. Wenn wir durch eine spontane Äußerung geschockt sind, (obwohl wir durch einschlägige Lektüre darauf vorbereitet sein sollten), verträgt eine Aussprache einen kleinen Aufschub, bis wir uns gesammelt haben. Dass der Aufschub nicht zu lange dauern darf, liegt auf der Hand.
Dabei müssen wir dem Verzweifelten mit Respekt und Liebe gegenübertreten. Abscheu und Vorwürfe bringen nichts, sie sind äußerst schädlich. Wir müssen ihm zeigen, dass wir bei ihm sind, dass wir auch an diesem Aspekt seiner momentanen Seelenlage teilnehmen. Wir können versuchen, ihn zu trösten. Wichtiger noch für den am Sinn seines Weiterlebens Zweifelnden ist, zu wissen, dass er sich auch mit diesen schwärzesten Gedanken an uns wenden und das ganze Ausmaß seiner Verzweiflung uns mitteilen kann. Er soll sich seiner Gedanken nicht schämen. Wenn er sie als Teil seiner Krankheit annimmt, verlieren sie an Wucht und Bedrohlichkeit.
Wir müssen ihm aber klarmachen, dass seine Handlungen endgültig sein können und nicht zu korrigieren sind. In seinem Leid ist sein Blick verengt und auf ihn selbst fokussiert. Wir müssen ihn darum vor die Tatsache stellen, dass er nicht allein auf dieser Welt ist und dass er an seine Nächsten denken soll, denen er lebenslanges Leid – Trauer, Schuldgefühle – zufügen würde. Gedanken, die ihm in seiner Verzweiflung vielleicht gar nicht kommen. Wir zeigen ihm damit auch, dass wir ihn ernst nehmen und dass er nach wie vor einen Platz in der Familie hat. Diese Überzeugungsaufgabe ist nicht einfach. Ich erlebte einen Fall, da eine gottesfürchtige und liebevolle Mutter versuchte, »davonzulaufen«, wie sie es nachher selber formulierte, obwohl sie einen leicht behinderten Sohn hatte, der dann im wahrsten Sinn des Wortes mutterseelenallein geblieben wäre. Wir müssen dem Todeswilligen also trotz allem die Frage stellen, ob er wirklich nichts und niemanden mehr nennen kann, wofür es sich zu leben lohnt.
Auf uns Angehörige, die wir vielleicht zum ersten Mal die Fratze des Todes – zumindest des »freiwilligen«, vermeidbaren – aus der Nähe erblicken, warten wieder einmal organisatorische Aufgaben und zwar solche, die keinen Aufschub und wenig Überlegen erleiden. Unser eigenes Erleben kommt in zweiter Linie.
Hat er gesagt, er habe genug von diesem Leben? Was heißt das? Wir werden unruhig, wenn wir nicht bei ihm sein können. Benützt er sein Alleinsein zu Taten, die unumkehrbar sind? Wir rufen von auswärts mehrmals zu Hause an und fragen ob
Weitere Kostenlose Bücher