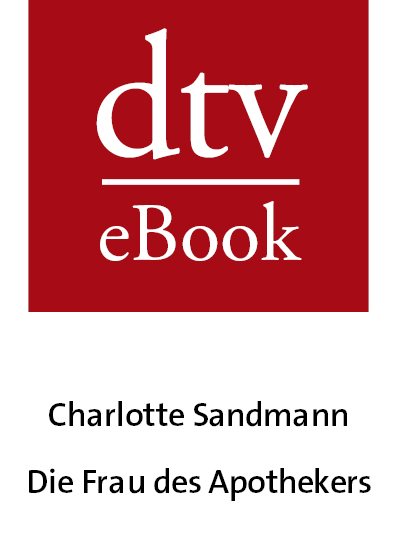![Die Frau des Apothekers - Sandmann, C: Frau des Apothekers]()
Die Frau des Apothekers - Sandmann, C: Frau des Apothekers
also wandte ich mich an den Provisor der Apotheke, Magister Schlesinger. Was für ein unangenehmer
Mensch! Er missfiel mir sofort. Kalt. Berechnend. Eine Persönlichkeit, die sich hinter einer ausdruckslosen Maske versteckte.
Als ich ihn nach der roten Scheibe fragte, verneinte er, etwas darüber zu wissen. Ich war überzeugt, dass er log – aber was
sollte ich tun, da ich doch selber nicht wusste, was es mit dem Objekt auf sich hatte?
Als die Rede auf Frau Paquins Schicksal kam, geriet der eben noch so frostige Provisor plötzlich in eine hitzige innere Bewegung.
Er richtete sich auf und blitzte mich durch seine dicken Brillengläser an.
›Sie nehmen an, dass Frau Paquin ihren Gatten ermorden wollte. Aber die Feststellung von Symptomen des Saturnismus besagt
nicht, dass der Verstorbene von seiner Frau geschädigt wurde, sie besagt in keiner Weise, dass er überhaupt mit Absicht geschädigt
wurde! Es gibt im ganz normalen Alltag genug Möglichkeiten, wie es zu einer Bleivergiftung kommen kann!‹ Seine bislang leise,
eintönige Stimme nahm einen zischenden Unterton an, der seine Erregung verriet.
›Das mag alles sein, Herr Magister‹, antwortete ich gelassen. ›Aber ich würde trotzdem gerne sehen, wo Sie die Gifte aufbewahren.‹
›Wozu das? Wir führen Metallpulver nur in ganz unbedeutenden Mengen.‹
Der Eifer in Schlesingers Augen erlosch, das Feuer seiner Rede zerfiel zu Asche. Er zeigte sich von Neuem höflich, aber alles
andere als kooperativ. Mit leiser, ausdrucksloser Stimme weigerte er sich, irgendwelche Auskünfte zu erteilen.
›Personen von außerhalb der Apotheke ist der Zutritt zum Aufbewahrungsraum für gefährliche Substanzen untersagt. Ich bin weder
verpflichtet noch berechtigt, Sie hineinzulassen. Bevor Sie mir nicht eine gerichtliche Aufforderung vorlegen, warte ich ab.‹
Er zog eine protzig verschnörkelte Uhr aus der Westentasche, warf mit gerunzelter Stirn einen Blick darauf und erklärte: ›Ich
habe eine wichtige Verabredung. Ich muss gehen, und ich bitte Sie, ebenfalls zu gehen. Wenn Sie mit einem richterlichen Befehl
wiederkommen, stehe ich Ihnen voll und ganz zur Verfügung.‹
Ich sah, dass ich gegen diesen eigensinnigen Pedanten nichts ausrichten würde, also zog ich mich fürs Erste zurück.«
2
Am Tag von Raoul Paquins Tod bestieg Emil Edler von Pritz-Toggenau eine Mietdroschke, denn eine eigene konnte er sich, verschuldet,
wie er war, nicht mehr leisten. Das Gefährt rumpelte eilig die Elbchaussee entlang, mit ihren neun Kilometern Länge die längste
bewohnte Straße Hamburgs und dem Vernehmen nach auch die reichste. Man hätte nicht glauben mögen, dass sich einst hier am
Ufer der Elbe entlang nur ein schmaler Sandweg erstreckt
hatte, bevor sich im achtzehnten Jahrhundert Kaufleute und Reeder ansiedelten. Von ihren Landhäusern und Villen aus öffnete
sich ein wunderschöner Blick auf den Fluss.
Der Oberleutnant hatte an diesem Vormittag freilich keinen Blick für landschaftliche Reize. Er war in äußerst verdrießlicher
Stimmung. Der Anblick des blutverschmierten Badezimmers hatte ihm schwer zugesetzt. Sich selbst gegenüber konnte er ja eingestehen,
dass er, der Prahlhans, der sich nicht genug tun konnte mit seinen Erzählungen von Schlachtenlärm und grausigen Gemetzeln,
in Wirklichkeit den Anblick von Blut und Leichen nicht ertrug. Er hatte einen Schreibtischposten bei der Armee inne und hoffte,
diesen niemals gegen das Schlachtfeld eintauschen zu müssen.
Onkel Raoul ist tot, ging es ihm wieder und wieder durch den Kopf. Das war unerfreulich, weil damit die Unterstützung wegfiel,
die der alte Herr ihm gewährt hatte. Andererseits war es auch erfreulich, weil Raoul persönlich ihm mitgeteilt hatte, dass
er ihn in seinem Testament reichlich bedenken würde. »Du wirst dieses Erbe zwar genauso verprassen wie alles andere Geld,
das dir in die Finger fällt«, hatte er gesagt, »aber du bist nun einmal der Sohn meiner Schwester und sollst nicht leer ausgehen.
Ich werde dir so viel hinterlassen, dass du mit einigem Verstand davon leben kannst. Wenn du diesen Verstand nicht hast, ist
es dein Pech. Dann kannst du meinetwegen in der Gosse enden.«
Er konnte nur hoffen, dass dieses Testament immer noch Gültigkeit hatte. In letzter Zeit war der Onkel ebenso konfus wie bösartig
gewesen. Ein ums andere Mal hatte er ihnen gedroht, dass er sie alle enterben würde. Das konnte er doch nicht wirklich getan
haben, oder?
Weitere Kostenlose Bücher