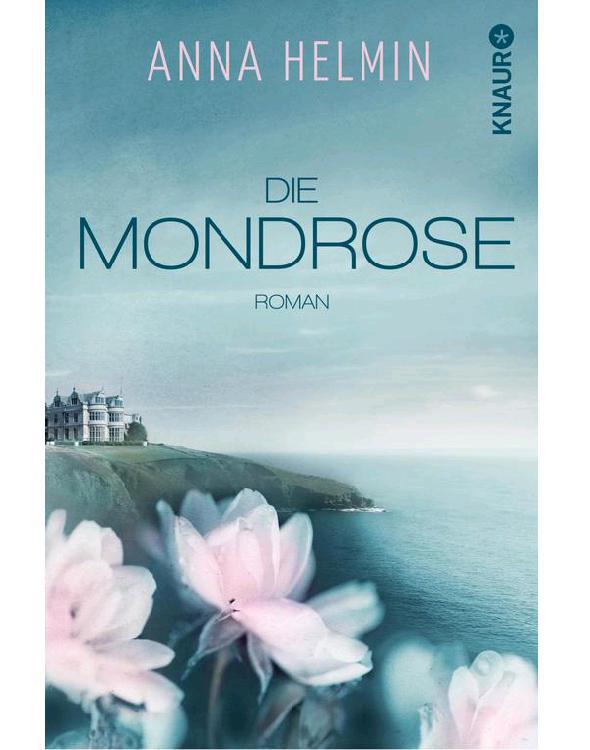![Die Mondrose]()
Die Mondrose
bekannt«, erwiderte Wolfe. »Mit Ihrem Bruder habe ich bereits gesprochen – er sagt, sein Name sei Hase. Also habe ich meine Hoffnung auf Sie verlegt. Sie sind als Geburtshelfer tätig, nicht wahr? Ich muss davon ausgehen, dass die Gesuchte, als sie hier ankam, hochschwanger war.«
Warum saß er hier? Warum ließ er sich von einer fremden Frau erzählen, die ihn nichts anging, einer der zahllosen Frauen, denen er nicht hatte helfen können? »Wenn sie schwanger war und in Milton’s Court wohnte, ist sie höchstwahrscheinlich tot«, sagte er. »Nur die Zähesten überleben, und als Ausländerin hätte sie vermutlich keine Hilfe gehabt.«
Wolfe nickte langsam. Er hatte das Gesicht in Falten gelegt, als nähme die Sorge um die fremde Frau ihn mit. Das hatte Hyperion an ihm gemocht – dass er sich um Daphne und Louis zu sorgen schien wie um eigene Verwandte. »Wann müsste die Entbindung denn gewesen sein?«, fragte er gegen seinen Willen.
»Vor etwa sechs Jahren. Im Winter.«
Hyperion rechnete nach. Vor sechs Jahren hatte Daphne ihm gesagt, dass sie ein Kind erwartete, und darauf gefolgt war die glücklichste Zeit seines Lebens. Aber begonnen hatte sie nicht glücklich. Auf einmal glaubte er das Gesicht der Frau vor sich zu sehen, die in jener Nacht nach einem Kaiserschnitt gestorben war. Er hatte das Richtige getan, davon war er bis heute überzeugt, und doch hatte er der Frau nicht helfen können. Die kleine Hatwick fiel ihm ein und der Mann Hannes, den er nicht gesucht hatte. Waren die beiden auch tot, oder war es Hannes, der den Detektiv mit der Suche beauftragt hatte? »Eine Ausländerin, sagen Sie?«, fragte er.
»Ja. Eine Deutsche.«
»Ich muss nachdenken. Falls mir etwas einfällt, sage ich es Ihnen bei unserer nächsten Zusammenkunft.« Wenn es wirklich Hannes war, der seine Frau suchte, dann war grausam, was er tat. Wie konnte er dem fremden Mann die Hölle zumuten, durch die er selbst ging, wie konnte er ihm Informationen vorenthalten? Er wusste, warum er es tat. Er fürchtete Wolfe zu verlieren, sobald dieser die Antworten aus ihm herausgeholt hatte. Und mit Wolfe hätte er auch seine Hoffnung verloren – ohne den Detektiv fiel ihm nichts mehr ein, das er noch hätte tun können.
»Lassen Sie sich Zeit«, erwiderte Wolfe freundlich und erhob sich. »Ich sende Ihnen wie immer eine Nachricht, einverstanden?«
»Ins Spital, nicht nach Mount Othrys.«
»Natürlich. Es ist bemerkenswert, dass Sie Ihr Haus stets beim Namen nennen. Ein anderer würde einfach nach Hause sagen.«
Hyperion zuckte mit den Schultern. Mount Othrys war kein Haus, sondern ein Grandhotel, und es war nicht sein Zuhause, sondern das von Mildred, aber nichts davon ging den Detektiv etwas an.
Auf dem Rückweg durch das verschlammte Land kam sein Leben ihm so leer vor wie nie zuvor, und in der Nacht konnte er, in der Leere wie in einem Käfig gefangen, nicht schlafen. Noch früher als sonst stand er auf. Als er das Altenteil, an dem gebaut wurde, verlassen wollte, kam ihm von der Kinderstube her eine kleine Gestalt mit wippenden Zöpfen hinterher. Wenn eins der Kinder versuchte mit ihm Kontakt aufzunehmen, tat er so, als würde er es nicht bemerken. Es war ihm unerträglich, mit ihnen umzugehen, und mit diesem, das vor ihm stand, war es am unerträglichsten. In ihrem Gesicht sah er Louis. Aber die knapp Vierjährige baute sich nun einmal so ernst und wichtig vor ihm auf und ballte die Fäuste in den Hüften, dass er sie unmöglich ignorieren konnte.
Sie trug ein weißes Kittelkleid, ordentliche Schnürstiefel und am Arm ein Kinderhandtäschchen. »Vater«, sagte sie entschlossen wie eine Erwachsene, »ich komme heute mit dir.«
Er wollte sie nicht ansehen. Wie sie die Stirn in Falten legte, wie das Licht des Wandarms sich in ihrem Haar fing, wollte er nicht bemerken. »Das geht nicht, Esther«, sagte er. »Da, wo ich hingehe, ist kein Platz für Kinder. Und du hast es hier ja auch schöner.«
Die Kleine schüttelte den Kopf, dass die Zöpfe flogen. »Hier hab ich’s nicht schön«, verkündete sie. »Ich gehe lieber mit dir und helfe dir, Leute gesund machen.«
Um ein Haar hätte er aufgelacht. »Ich mache nur wenige Leute gesund«, entfuhr es ihm. »Den meisten sehe ich beim Sterben zu.«
Um zu überlegen, stützte sie ihr Kinn auf eine Faust. »Dann komme ich auch und sehe beim Sterben zu«, sagte sie schließlich. »Will Sterben sehen. Ist Sterben schön?«
Jäh erinnerte er sich, wie reif Louis für sein Alter
Weitere Kostenlose Bücher