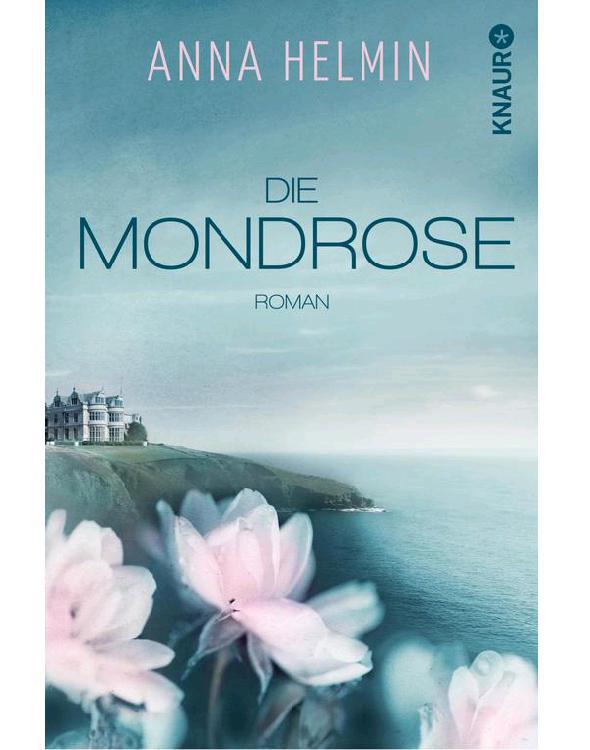![Die Mondrose]()
Die Mondrose
wünsche mir so sehr ein Kind.«
Womöglich war Esther, die jedes medizinische Fachbuch gelesen und bei Geburten assistiert hatte, erst in dieser Nacht klargeworden, dass darin das Ziel des Aktes, der sie so quälte, bestand – ein Kind, das in ihrem Körper heranwuchs. Ein lebendiges Wesen, das ihr eine Aufgabe schenkte. Seither wollten sie es beide, und mit dem Gedanken daran ließ sich der Akt ertragen. Aber inzwischen waren vier Jahre verstrichen, Phoebe hatte drei Kinder zur Welt gebracht, und Esther war nicht einmal schwanger geworden. Während Andrew ihr traurige Blicke aus seinen Spanielaugen sandte und beteuerte, er werfe ihr nichts vor, suchte Esther ohne sein Wissen Ackroyd auf und bat ihn, sie zu untersuchen. Er tat ihr den Willen, fand nichts, das einer Schwangerschaft im Weg stünde, und bekundete, die meisten Fälle ihrer Art blieben der Medizin unerklärlich. Man könne nichts anderes tun, als sich abzufinden.
»Ich weiß«, sagte Esther. »Die Idee war töricht. Ich hatte nur gedacht, ich hätte vielleicht etwas von meiner Mutter geerbt – ihre Blutarmut oder anderes.«
»Ihre Mutter hat zwei völlig gesunde Kinder geboren«, widersprach Ackroyd. »Und was ich schon immer einmal fragen wollte: Wie kommen Sie eigentlich alle darauf, sie sei blutarm gewesen?«
»Ich weiß nicht«, bekannte Esther verwundert, »jeder sagt es doch.«
»Ja, jeder sagt es«, stimmte Ackroyd zu, »aber verstanden habe ich es nie. Soweit ich weiß, war sie nicht blutarm, sondern höchstens ein wenig zart, wie Sie es auch sind. Aber zäh war sie nicht minder. Immerhin hat sie einen Anfall von Fleckfieber unbeschadet überlebt. Wissen Sie, was ich manchmal denke? Man kann einen Menschen auch krank pflegen, und man muss es dabei nicht einmal schlecht mit ihm meinen.«
Esther hatte beschlossen, über die verstörenden Worte nicht nachzugrübeln, sondern sich mit dem zu befassen, was sie betraf. Warum sie kein Kind bekam, wusste kein Mensch, folglich konnte auch kein Mensch ihr helfen. Sie musste sich weiter quälen, bis der letzte Rest von Hoffnung schwand.
Sich jetzt auf Chastity zu konzentrieren, mochte ihr guttun. Wie es aussah, war sie das einzige Mitglied der Familie, das dafür Zeit und Interesse aufbrachte und über entsprechende Mittel verfügte. Geld war in ihrem Haus kein Problem. Das Victoriana war eine Goldgrube, und Andrew hatte ihr ein privates Konto eingerichtet. Am Abend ihrer Verlobungsfeier hatte sie zu ihm gesagt: »Ich werde Geld brauchen, um meine Familie zu unterstützen.«
Er hatte genickt. »Du hast deshalb eingewilligt, mich zu heiraten, nicht wahr?«
»Ja«, hatte Esther erwidert, denn zu lügen erschien ihr noch grausamer. »Ich verstehe, wenn du die Verlobung lösen willst.«
»Ich will sie nicht lösen«, hatte Andrew gesagt. »Dass du mich lieben könntest, habe ich mir nie eingebildet. Ich werde dir ein eigenes Konto einrichten, mit dem du schalten und walten kannst, wie du willst.«
Für die Suche nach Chastity würde das Geld ihr zupasskommen. Sie beschloss zu tun, was Horatio ihr geraten hatte, sandte ein Billett ins Spital und bat ihren Vater um ein Treffen. Auf eine Antwort musste sie tagelang warten, dann aber willigte der Vater ein, und neue Billetts wurden versandt, um einen Tag zu vereinbaren. Wir verkehren miteinander, als wäre ich wahrhaftig nach Kanada ausgewandert, dachte Esther. Was sie sich von dem Treffen versprach, wusste sie selbst nicht, doch sie wollte nichts unversucht lassen.
Kapitel 46
Hochsommer
T agsüber saß Hedwig am Empfang der Pension, in der Onkel Victor zu arbeiten hatte. Es ging ihr mit jedem Tag besser. Solange das Mädchen, das hinter dem Tresen den Gästen ihre Schlüssel und die Marken für das Restaurant aushändigte, sie vor Grüßen und Fragen abschirmte, vermochte sie die Angst im Zaum zu halten. Irgendwann würde es ihr selbstverständlich sein, hier zu sitzen, und dann würde sie aufstehen, hinter dem Tresen hervortauchen und hinaus in die sommerliche Welt laufen.
In ihre Welt! In der Horatio auf sie wartete. Wenn die Angst aufzuwallen drohte, sprach sie sich seinen Namen vor oder zählte die Tage bis zu seinem nächsten Besuch. Nie ließ sie ihn gehen, ehe er ihr einen weiteren Besuch versprochen hatte. »Ich kann nicht gesund werden, wenn Sie nicht wiederkommen«, sagte sie. »Sie helfen mir mehr als alle Ärzte. Mein Lebensretter sind Sie.«
Dass Horatio sich sträubte, dass er nicht aufhörte ihr zu beteuern, es sei besser, wenn sie
Weitere Kostenlose Bücher