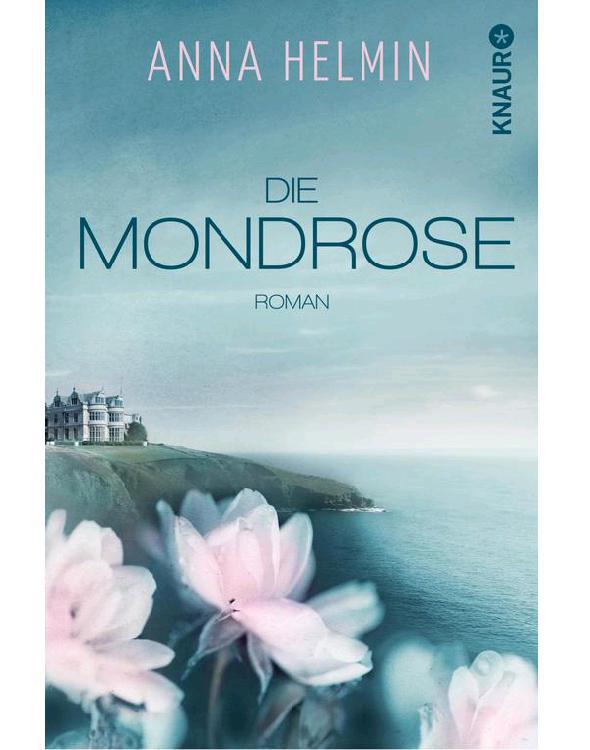![Die Mondrose]()
Die Mondrose
keinen etwas an.
»Das Gesetz geht es an!«, hatte Mildred sie angeschrien, aber die Frau hatte sich nicht erschüttern lassen.
»Wenn es Sie selig macht, melden Sie mich der Polizei«, hatte sie gesagt und Mildred stehenlassen.
Mildred hatte niemanden gemeldet, sie hatte Hyperion gefragt, und der hatte die Stirn besessen, ihr zu erklären: »Ich bin nicht Arzt geworden, um Leben zu nehmen, Mildred.« Zudem bedeute eine Tötung des Kindes in so spätem Stadium der Schwangerschaft auch die Tötung der Mutter. Das Kind, das niemand wollte, war zur Welt gekommen und hatte seiner Familie Segen gebracht wie kein zweites. Hyperion hatte es anfangs so wenig beachtet wie seine Töchter, aber Selene ließ ihn damit nicht davonkommen, sondern bahnte sich auf festen Beinchen ihren Weg in sein Leben. Mit ihr hatte sich ein Lächeln zurück auf sein Gesicht gestohlen. Jetzt kniete sie vor seinem Bett und streichelte seine Fäuste. Mildred blieb keine Wahl. Sie konnte sie nicht gehen lassen, sie musste zu unfeinen Mitteln greifen.
»Was glaubst du, was du deinem Großvater antust, wenn du so sprichst?«, fragte sie. »Ist dir nicht klar, dass du ihn mit dem, was du uns antust, ins Grab bringst, willst du dir das auf dein Gewissen laden?« Sie sah, dass Ackroyd protestieren wollte, doch ein Blick von ihr brachte ihn zum Schweigen. Mildred atmete auf. In der Nacht vor Selenes Geburt hatte die stille, fügsame Esther ihr ins Gesicht geschrien, sie sei wahrhaftig eine Titanin – das weibliche Ebenbild des Kronos, das seine eigenen Kinder verschlinge. Esther hatte damals nichts verstanden, aber sie würde heute verstehen. Mildred war jedes Mittel recht gewesen, um ihre Tochter nicht zu verlieren. Heute galt dasselbe für ihre Enkelin.
Selene presste ihr Gesicht an Hyperions Seite ins Laken. Als sie es wieder hob, war sie so gefasst, wie Mildred sie kannte. »Du kannst mich hören, nicht wahr, Großvater?«, fragte sie. »Natürlich gehe ich nicht weg, solange du krank bist. Ich bleibe hier, bis es dir bessergeht.«
Noch einmal und jetzt viel tiefer atmete Mildred auf. Fürs Erste war die Gefahr gebannt, und wenn Selene später noch einmal davon anfing, würde sie sich etwas Neues einfallen lassen. Sie sah in Hyperions Gesicht, über das eine Bewegung strich. Konnte er Selene tatsächlich hören? Wenn du mich hören kannst, sage ich dir alles, versprach sie ihm stumm. Später, wenn die anderen gegangen und wir beide allein sind, sage ich es dir, damit du es weißt, bevor du stirbst. Damit du mich erlöst.
Als hätten sich wieder einmal alle schwarzen Kräfte des Schicksals verschworen, um sie in die Knie zu zwingen, fand Mildred in der Nacht, als sie endlich dazu kam, sich um die Post zu kümmern, noch einen der gefürchteten Briefe vor. Keinen des Erpressers, der sich seit Jahren an Summen hielt, die ihr zwar Wochen der Nöte, aber keine Panik mehr bescherten. Diese anderen Briefe hingegen lösten das alte Gefühl, übermannt zu werden, aus, für das sie sich zu alt fühlte, zu mutlos, zu erschöpft. Dabei hatten die Briefe bisher nicht einmal echte Gefahr bedeutet, sondern nur an all das Beklemmende, Dunkle gerührt, das sie mit niemandem teilen durfte. Als wäre das nicht genug, trat in dieser Nacht die echte Gefahr noch dazu.
»Mildred«, las sie ihren Namen in der steilen, wohlbekannten Schrift. »Ich lasse mich noch einmal herab, Dich zu bitten, dann habe ich keine Kraft mehr dazu und muss andere Wege beschreiten. Du weißt, dass mein Sohn in den Kämpfen mit den Buren gefallen ist. Du wirst auch wissen, dass meine Kleine an einer grausamen Krankheit zugrunde geht und dem Tod schon näher steht als dem Leben. Es wird Dir Genugtuung bereiten, dass von mir nur ein einsames Wrack von einem Mann verblieben ist. Kannst Du selbst mit diesem Wrack keine Spur von Mitleid haben?«
Und wenn ich es könnte, was nützte uns das? Immer redeten alle vom Mitleid, ohne das man sich angeblich dem Menschengeschlecht nicht zurechnen durfte, und doch war es ein gänzlich nutzloses Gefühl.
»Ich verlange von Dir nur, dass Du mich wissen lässt, wo meine Tochter und mein Enkelkind leben. Ich will nichts als sie sehen. Einmal in ihnen erkennen, dass trotz aller Fehler, die ich in meinem Leben begangen habe, meine Geschichte mit mir nicht endet. Dass etwas Gutes geblieben ist von so viel Schlechtem. Willst Du mir das verweigern, Mildred?«
Das wollte sie in der Tat, und sie würde es bis ans Ende ihres Lebens tun. Die, die vom Mitleid
Weitere Kostenlose Bücher