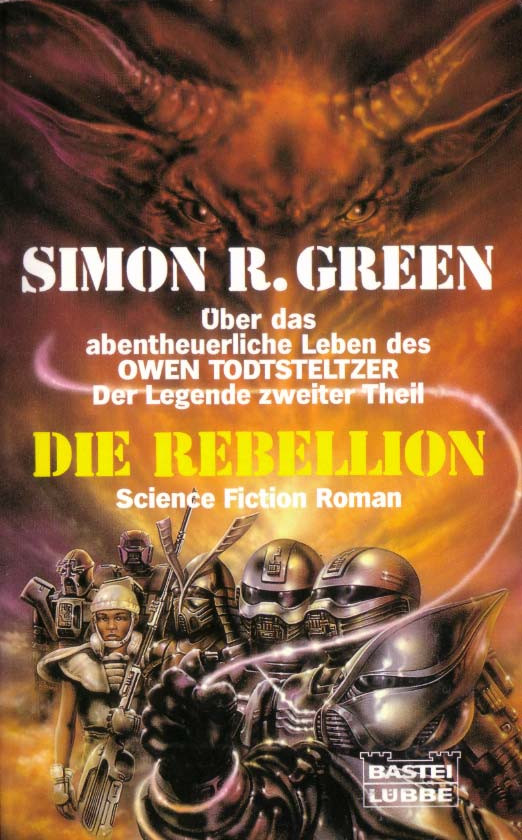![Die Rebellion]()
Die Rebellion
auch Lily da.
Schließlich ist sie deine Frau, nicht wahr?«
»Ich habe keine Ahnung, wo sie steckt«, entgegnete Daniel.
»Sie ist nie da, wenn, ich sie brauche. Nicht, daß ich einen
Dreck darauf gebe. Ihr endloses Geplapper raubt mir den letzten Nerv. Nicht ein einziges vernünftiges Wort kommt aus ihrem Mund. Manchmal denke ich, Vater hat sie als meine Frau
ausgesucht, um sich einen Scherz zu erlauben.«
»Ich weiß, was du meinst«, stimmte Stephanie ihrem Bruder
zu. »Michael ist keine Spur besser. Gut gebaut, aber zwischen
den Ohren hat er nichts außer seinem Appetit. Er vergißt ständig Besorgungen oder Verabredungen, und dann hat er auch
noch den Nerv zu schmollen, wenn ich ihn anschreie. Er ist
ganz gut im Bett, aber er besitzt die Persönlichkeit und den
Charme eines weichgekochten Eis. Wir hätten niemals unser
Einverständnis zu diesen Hochzeiten geben sollen.«
»Uns blieb doch gar keine andere Wahl. Du hast doch sein
Testament gesehen; entweder wir heiraten, oder wir werden
enterbt. Und wir benötigten die Geschäfte, die damit einhergingen.«
»Wir haben die Geschäfte jetzt. So, das wäre geschafft. Faß
deine Krawatte nicht mehr an, unter gar keinen Umständen.
Hast du verstanden? Gut. Du hast sicher recht, natürlich. Unsere Ehegatten sind so nützlich wie … ach, ich weiß nicht. Such
dir irgend etwas wirklich Nutzloses aus.«
»Lily und Michael«, sagte Daniel, und Stephanie mußte grinsen, wenn auch nur schwach.
»Richtig«, bestätigte sie trocken. »Ich würde mich in der
nächsten Sekunde scheiden lassen, wenn ich nicht sicher wäre,
daß er die Gelegenheit ausnutzt und mich bis auf den letzten
Kredit aussaugt, wenn er schon seine Finger nicht im Familiengeschäft lassen kann. Wir hätten auf Eheverträgen und Gütertrennung bestehen sollen, aber das Testament unseres lieben
Herrn Papa ließ das nicht zu. Aber egal. Es ist mein Geschäft,
und es ist mein Geld, und Michael kriegt nichts davon in die
Finger. Vorher ist er tot und verfault leise in seinem Grab.«
»Na, das ist doch mal eine Idee«, sagte Daniel. Stephanie
blickte rasch auf, um zu sehen, ob ihr Bruder den Gedanken
aufnahm, aber sie erkannte an seinem gedankenverlorenen
Blick, daß er nur höflich gewesen und längst bei einem anderen
Thema war. »Stephanie, wie lange müssen wir noch hier auf Technos III bleiben, wenn die Zeremonie vorüber ist?«
»Daniel, das haben wir doch bereits alles besprochen. Mindestens noch zwei Monate, vielleicht sogar drei. Selbst wenn wir
die kleine Überraschung mit einrechnen, die wir geplant haben,
wird es noch eine Zeitlang dauern, dem lieben Valentin die
Kontrolle über die Fabrik zu entwinden.«
»Dazu brauchst du mich nicht hier. Du brauchst mich überhaupt nicht hier. Ich muß weg. Ich habe etwas viel Wichtigeres
zu tun.«
»Danny …«
»Unser Vater ist noch immer irgendwo dort draußen. Ich
kann ihn finden, ich weiß es. Hinter mir stehen alle Ressourcen
der Wolfs.«
»Danny, unser Vater ist tot. Er starb im Kampf mit den Feldglöcks. Du hast nur den Körper gesehen. Was du und ich bei
Hof gesehen haben, war ein Geistkrieger, sonst nichts. Ein
Körper mit implantierten Lektronen, die ihn in Bewegung halten und sprechen lassen.«
»Nein! Es war er ! Er hat mich erkannt. Er lebt noch und ist in
diesem verwesenden Körper gefangen! Ich muß ihn finden,
koste es, was es wolle.«
»Hör auf damit, Danny. Unser Vater ist Vergangenheit, in
welchem Zustand er sich auch jetzt befinden mag. Wir müssen
den Blick in die Zukunft richten. Er hat sich nie um uns geschert. Ihm ging es nur darum, daß jemand die Gene der Familie weitergibt. Ich brauche dich. Ich brauche deine Unterstützung, hier und am Hof. Ich kann Valentin nicht von seinem
Sockel stürzen und diese Familie allein regieren. Ich brauche
deine Hilfe, Daniel! Ich habe sie immer gebraucht, das weißt
du!«
»Warum? Damit ich an deiner Seite stehe und einen guten
Eindruck erwecke? Duelle wegen deiner Ehre ausfechte? Dir
die Hand halte, wenn die Dinge ein wenig rauh werden? Dazu
hast du Michael, und wenn der nichts taugt, kannst du jemand
anderen einstellen. Die einzigen wirklichen Kämpfe drehen
sich um Geld und Politik, und von beidem habe ich noch nie
etwas verstanden. Ich muß gehen, Stephanie. Vater braucht
mich. Niemand sonst wird ihm helfen. Die meisten Menschen
sind froh, daß er tot ist. Ich bin alles, was er noch hat.«
»Unser Vater ist tot! Wie oft muß ich dir das noch sagen?
Wann
Weitere Kostenlose Bücher