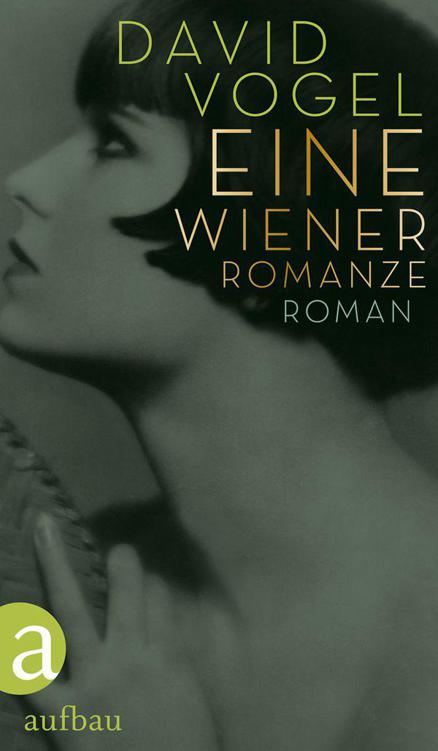![Eine Wiener Romanze: Roman (German Edition)]()
Eine Wiener Romanze: Roman (German Edition)
Stimme zu lauschen, auch unabhängig vom Gesagten. Eine gezügelte innere Flamme verbarg sich darin, vielleicht sogar leichte, unterschwellige Traurigkeit. Je besser Rost ihnkannte, desto höher achtete er ihn – dieser Mann hatte nichts Kleinliches an sich, er könnte nie arm sein, auch wenn er kein Geld hätte. Auf einmal begriff er, dass das Kapital, das Dean angehäuft hatte, ihm nur als Mittel diente, um sich seiner eigenen Kraft zu vergewissern, wie einer, der sich ein Ziel in einem an sich unwichtigen Spiel setzt.
Draußen ging feiner, erfrischender Regen nieder, wurde klammheimlich von den Baumwipfeln aufgesogen. Durch die offene Terrassentür drang von Zeit zu Zeit ein leises, fast zögerndes Rascheln ein.
»Das Militär wird schon zum Überdruss«, ließ sich Felix von Brunnhof nach anhaltendem Schweigen vernehmen, »es packt mich nicht mehr.«
»Aber die Uniform steht Ihnen gut!« Gisela nahm vor ihm Aufstellung und musterte ihn, als sähe sie ihn zum ersten Mal. »Ich kann Sie mir gar nicht in Zivil vorstellen.«
»Nicht deshalb!«, schnauzte der Offizier wegwerfend, ohne sie groß zu beachten, und sagte dann an alle gerichtet: »Ich bin dort fehl am Platz. Habe keine Lust zu dem ganzen Kram.« Sein Ton war gemäßigt und besonnen.
»Wenn Sie schon an diesem Punkt angelangt sind, können Sie nur die Finger davon lassen«, äußerte Peter Dean seine Meinung.
»Demnächst werde ich meinen Abschied nehmen.«
»Und dann werden wir Sie nicht mehr so häufig sehen.« Frau Dean drückte den Zigarettenstummel im Aschenbecher aus.
»Das habe ich nicht gesagt.« Einen Augenblick später: »Ich werde eine Auslandsreise unternehmen. Nach Italien, nach Frankreich, vielleicht noch wohin.« Er griff sich an den schütteren Schnurrbart, als wolle er ihn zwirbeln. Dies war seine typische Geste, den engeren Bekannten wohlvertraut, die ein letztes Zögern vor der endgültigen Entscheidung signalisierte.
Rost, der seitlich zur Terrasse saß, wandte leicht den Kopf und blickte hinaus, sah vage die schrägen Regenschnüre zwischen den Bäumen, Schnüre, die Oben und Unten zusammenbanden.
Er dachte an Gertrud, an den verzweifelten, flehenden Blick, den sie ihm heute Morgen zugeworfen hatte, als er ihr im Weggehen auf dem Flur begegnet war. Herr Georg Stift, der dabei gewesen war, hatte ihn mit der Jovialität eines Mannes begrüßt, der sich seines Besitzstands völlig sicher ist, und den Blick seiner Frau natürlich nicht aufgefangen. Und er selbst, Rost, hatte so getan, als merke er nichts. Warum? War sie denn keine sympathische Frau, die ihm lieb und teuer war, diese Gertrud von gestern und vorgestern mit all ihren Körperpartien? Warum hatte er dann dafür gesorgt, dass ihr Blick an einer ehernen Rüstung abprallte und zu ihr zurückgeworfen wurde? Er erinnerte sich jetzt, dass ihn dabei ein flüchtiger Unwille befallen hatte. Sicher war er aus Enttäuschung so stur aufgetreten. Irgendwie hatte er sich eingeredet, er würde Erna begegnen, gerade ihr. Ein paarmal war er sogar grundlos auf den Flur gegangen, in der leisen Hoffnung, sie dort zu sehen. Nein, die hatte sich nicht blicken lassen, wie zum Trotz.
Jetzt kam Gisela Fuchstaler an und setzte sich neben ihn, ständig bereit, wieder aufzuspringen. Im Geist hatte sie schon einen kleinen Plan ausgeheckt. Hastig puderte sie sich die Nase vor dem Spiegel an der Innenseite ihrer Handtasche. Der Rosenduft des Puders, der sie dabei umwehte, war Rost unangenehm.
»Und Sie, junger Herr«, sprach sie ihn an, »wie haben Sie vor, ins Ausland zu reisen?«
»Ich habe nicht vor, zu verreisen.« Rost gab seiner Stimme einen leicht dreisten und abfälligen Unterton. Diese sprunghafte und hohle Frau ging ihm bereits auf die Nerven.
»Schade, ich kenne jemanden, mit dem sie als Begleiter reisen könnten.«
Rost blickte sie einen Moment durchdringend an. Dann sagte er, jedes Wort betonend: » Ich bin kein Begleiter , gnädige Frau.«
Ein unwilliger Zug huschte über ihr Gesicht, doch gleich darauf entblößte sie die Zähne zu einem bezaubernden Lachen. »Ich habe es nicht böse gemeint, kein bisschen böse.«
»In Italien dürfen Sie Florenz nicht versäumen, da gibt’s was zu sehen«, ließ sich Herr Stans vernehmen. Wenn Herr Stans von einem Ort oder einem Menschen sagte, »da gibt’s was zu sehen«, meinte er immer etwas Besonderes, das kein Mensch außer ihm zu erkennen vermochte. Neben diversen Immobilien besaß er eine Maschinenfabrik gemeinsam mit seinem Bruder,
Weitere Kostenlose Bücher