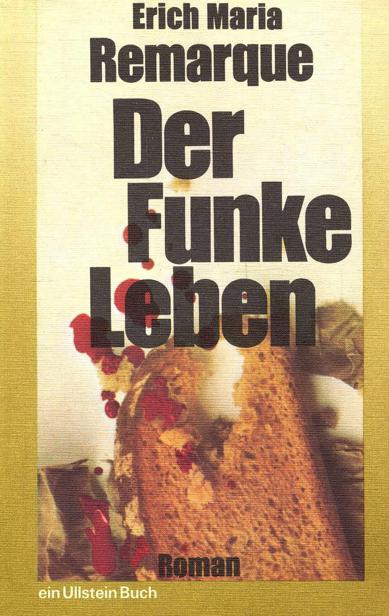![E.M. Remarque]()
E.M. Remarque
drüben.«
Bucher blickte zu dem weißen Haus auf dem Hügel jenseits des Lagers
hinüber. Es stand in der schrägen Sonne zwischen den Bäumen und schien
unversehrt. Die Bäume des Gartens hatten einen hellen Schimmer, als seien sie
überflogen vom ersten Rosa und Weiß der Kirschblüten.
»Glaubst du es jetzt endlich?« fragte er. »Du kannst ihre Kanonen hören. Sie
kommen jede Stunde näher. Wir kommen heraus.«
Er sah wieder auf das weiße Haus. Es war sein Aberglaube, daß, solange es heil
war, alles gut werden würde. Ruth und er würden am Leben bleiben und gerettet
werden.
»Ja.« Ruth hockte neben dem Stacheldraht. »Und wohin sollen wir gehen, wenn wir
hinauskommen?« fragte sie.
»Weg von hier. So weit wie möglich.«
»Wohin?«
»Irgendwohin. Vielleicht lebt mein Vater noch.«
Bucher glaubte es nicht; aber er wußte nicht genau, ob sein Vater tot war. 509
wußte es, doch er hatte es ihm nie gesagt.
»Bei mir lebt niemand mehr«, sagte Ruth. »Ich war dabei, als man sie abholte zu
den Gaskammern.«
»Vielleicht sind sie nur auf einen Transport geschickt worden. Oder man hat sie
anderswo leben lassen. Dich hat man doch auch leben lassen.«
»Ja«, erwiderte Ruth. »Mich hat man leben lassen.«
»Wir hatten in Münster ein kleines Haus. Vielleicht steht es noch. Man hat es
uns weggenommen. Wenn es noch steht, werden wir es vielleicht wiederbekommen.
Wir können dann hinfahren und dort unterkommen.«
Ruth Holland antwortete nicht. Bucher blickte zu ihr hinüber und sah, daß sie
weinte.
Er hatte sie fast nie weinen sehen und glaubte, es sei, weil sie sich an ihre
toten Angehörigen erinnert hatte. Tod aber war etwas so Alltägliches im Lager,
daß es ihm übertrieben schien, nach so langer Zeit noch so viel Schmerz zu
zeigen. »Wir dürfen nicht zurückdenken, Ruth«, sagte er mit einem Schatten von
Ungeduld. »Wie sollten wir sonst jemals wieder leben können«
»Ich denke nicht zurück.«
»Warum weinst du dann?«
Ruth Holland wischte die Tränen mit den geballten Händen aus den Augen. »Willst
du wissen, weshalb man mich nicht vergast hat?« fragte sie.
Bucher spürte unklar, daß etwas kam, von dem er besser nichts wußte. »Du
brauchst es mir nicht zu sagen«, erklärte er, »Aber du kannst es auch sagen,
wenn du willst. Es macht nichts aus.«
»Es macht etwas aus. Ich war siebzehn Jahre alt. Damals war ich nicht so
häßlich wie heute. Deshalb ließ man mich leben.«
»Ja«, sagte Bucher, ohne sie zu verstehen. Sie blickte ihn an.
Er sah zum ersten Male, daß sie sehr durchsichtige, graue Augen hatte. Früher
hatte er es nie so gemerkt. »Begreifst du nicht, was das heißt?« fragte sie.
»Nein.«
»Man ließ mich leben, weil man Frauen brauchte. Junge – für die Soldaten. Für
die Ukrainer auch, die mit den Deutschen zusammen kämpften. Begreifst du es
nun?«
Bucher saß einen Augenblick wie betäubt. Ruth beobachtete ihn. »Das haben sie
mit dir getan?« fragte er schließlich. Er sah sie nicht an.
»Ja. Das haben sie mit mir getan.« Sie weinte nicht mehr.
»Es ist nicht wahr.«
»Es ist wahr.«
»Ich meine es nicht so. Ich meine, daß du es nicht gewollt hast.«
Sie brach in ein kurzes, bitteres Lachen aus. »Da ist kein Unterschied.«
Bucher sah sie jetzt an. In ihrem Gesicht schien jeder Ausdruck erloschen zu
sein; aber gerade das machte es zu einer solchen Maske des Schmerzes, daß er
plötzlich fühlte und nicht nur hörte, daß sie die Wahrheit gesagt hatte. Er
fühlte es, als zerreiße es seinen Magen; aber gleichzeitig wollte er es nicht
anerkennen, noch nicht – er wollte im Moment nur eins: daß dieses Gesicht vor
ihm sich ändere.
»Es ist nicht wahr«, sagte er. »Du hast es nicht gewollt. Du warst nicht dabei.
Du hast es nicht getan.«
Ihr Blick kam aus einer Leere zurück. »Es ist wahr. Und man kann es nicht
vergessen.«
»Niemand von uns weiß, was er
Weitere Kostenlose Bücher