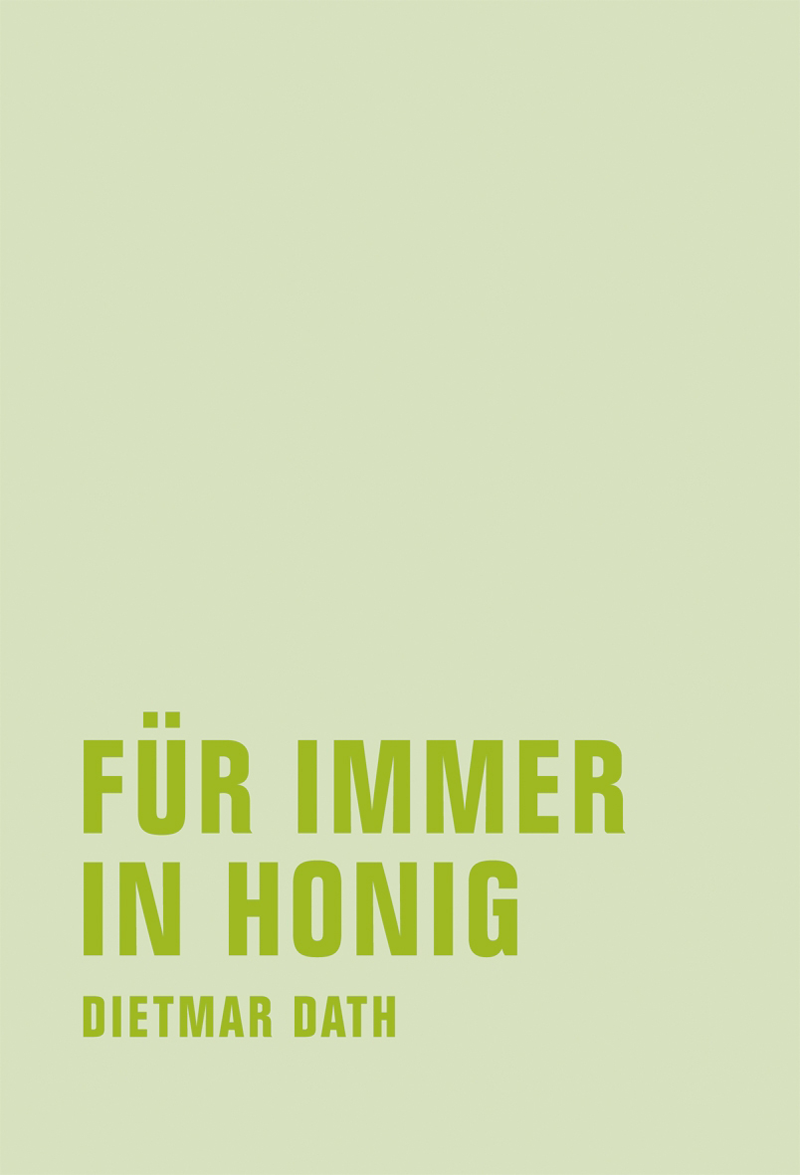![Für immer in Honig]()
Für immer in Honig
aber hysterischen und unzuverlässigen Zuständen aufgewachsen, und wollte also »was besseres« werden. Literatur, das hieß, als ich dreizehn und vierzehn war: Die Moderne, am liebsten Bücher, die sich schämen, ein Ende zu finden, Bücher, die sich zu fein sind, einen Anfang zuzulassen, Mäandern, Seelengekräusel. Und Popmusik? Na gut, also David Bowie, das ist ja fast Chanson, das ließ ich grad noch so gelten.
Viel später erst entdeckte ich, daß Bowie in Wirklichkeit, in Wirksamkeit ein Rocker war. Da war ich schon selbst ein Rocker. Stephen King und Heavy Metal habe ich, Kind eines herumreisenden kaufmännischen Säufers und einer zahntechnischen gefährlichen Irren, von Philip Klatt gelernt, dem behüteten Sohn eines solide in der Verwaltung Festangestellten und seiner braven Hausfrau.
Bis dahin beherrschte mich der genaugenommen dümmste Aberglaube: Lesen und hören muß man, um die Unruhe, den Haß, die Wirrnis im eigenen Kopf abzutöten, zu betäuben, mit elegischen Stimmungen zuzuschütten. Kunst war mir Firnis, Abdeckfarbe, beflissenes Übertönen der Fürze der Hölle.
Dann begriff ich: Lesen kann auch heißen, diese Zustände genauer anzuschauen, furchtloser, als der verängstigte Kopf sich das ohne die Hilfe von Geschichten und anderen ästhetischen Umwegen trauen würde. Und Wut kann man in etwas verwandeln, das sozusagen Musik ist.
Gerettet. Zusammengeflickt. Geheilt.
Kunst als Ausweg, nicht die brodelnden Zustände niederhalten, sondern: als würdiger, eben nicht fauler Kompromiß, Vermittlungsvorschlag an die Welt, die diese Zustände roh nicht ertragen würde. Da erinnerte ich mich dann auch an den kleinen Aufsatz über die Katze: Stimmt, das weißt du eigentlich alles schon seit der Grundschule.
Except immigrants & residents.
»Warum nach Israel?« hatte ich Skriba, meinen Chef, noch am Boarding Gate gefragt, und mit der Antwort beschämte er mich das erste, nicht das letzte Mal: »Ich bin Jude, Herr Rolf. Wenn ich Deutschland verlassen muß, das Land, in dem ich gelebt habe, gestorben bin und noch einmal gelebt habe, gibt es nur einen Ort, den ich aufsuchen will.« Daß ich keine Wahl hatte als die, ihn zu begleiten, mußten wir nicht besprechen.
Er hatte mich aus dem Matsch gezogen, er hatte mich zurückgeholt, er hatte es auf sich genommen, mir zu zeigen, daß es ein Leben nach Valerie, nach Berlin, nach der Zeitung, nach den mehr oder weniger schiefen Versuchen, das Schreiben und das Erwachsensein und gefälligst Geldverdienen-Sollen irgendwie zusammenzubacken, geben konnte, und das mindeste, was ich ihm dafür schuldete, war, dahin zu gehen, wohin er mich mitnehmen wollte. Wie schon drei Jahre vorher, als ich das Land zum ersten Mal betreten hatte – damals mit einer Mediengruppe der Bertelsmannstiftung, i.e. junge Dokumentarfilmer, ein Typ vom Kunstmuseum, eine junge Drehbuchautorin, ein Dirigent, diese Sorte Menschen, ich durfte mit, weil ich bei der Zeitung war –, fiel mir auf, wie wenig Zombotiker man sah; im Flugzeug, am Flughafen. Ich darf fast ganz ohne Unaufrichtigkeit sagen, daß von dem Moment an, da wir die Paßkontrollen passiert hatten – es gab keine Scherereien, das war nicht die einzige Gelegenheit, bei der Skriba mir die Dinge schlimmer gemalt hatte, als sie waren –, Skriba der einzige Zombotiker war, den ich für die nun folgenden vier, fünf oder sechs Jahre (es gibt immer noch keine Möglichkeit, das festzustellen, nicht einmal im Internet) zu Gesicht bekam.
Beinah ganz ohne Unaufrichtigkeit: Denn natürlich weiß ich inzwischen, daß ich im Irrtum war, als ich Skriba für einen Zombotiker hielt. Genau wie Valerie und die arme Stefanie, die mit ihr Skribas Lokal in Berlin besucht hatte, schloß ich von der Tatsache, daß er offensichtlich in einem toten Körper lebte, oder doch in einem Körper, der eigentlich hätte tot sein sollen, auf die Art und Weise, mit der man ihn wiederbelebt haben mußte.
Daß ich, wenn es nur diese eine, die mythizinische, gab, jetzt auch selbst ein Zombotiker sein mußte, fiel mir dabei nicht ein. Mein Denken war nicht das klarste zu dieser Zeit. Sehr viel klarer ist es immer noch nicht, aber etwas besser geht es nun.
Zwei in paramilitärische Sachen gekleidete Leute holten uns ab: 1.) die junge »Chica«, wie sie sich selbst nennt, eine Frau, die ich seither nie anders erlebt habe als in Hektik, und die ganze Abende mit Skriba streitend – gutmütig allerdings, sie mögen sich – im Zelt sitzt und einen Tequila nach
Weitere Kostenlose Bücher