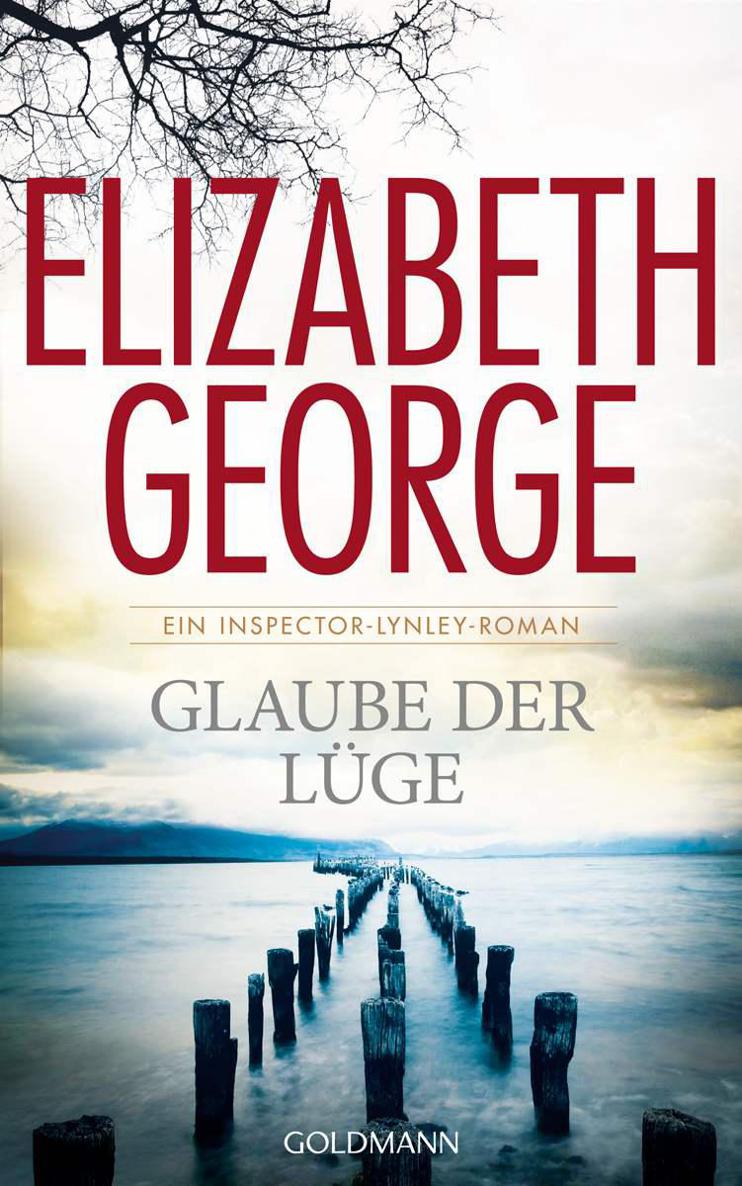![Glaube der Lüge: Ein Inspector-Lynley-Roman (German Edition)]()
Glaube der Lüge: Ein Inspector-Lynley-Roman (German Edition)
dazugehört, aber dann hast du es dir anders überlegt. Und wenn du glaubst …«
»Rede nicht in dem Ton mit Freddie!«, fiel Manette ihm ins Wort. »Du kannst froh sein, dass du ihn hast. Wir können alle froh sein, dass wir ihn haben. Unter denen, die in der Firma einen verantwortungsvollen Posten bekleiden, scheint er der einzige Ehrliche zu sein.«
»Dich eingeschlossen?«, fragte ihr Vater.
»Ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt«, antwortete sie, »denn auf jeden Fall schließt es dich ein.« Vielleicht, dachte sie, hätte sie letztendlich alles für sich behalten, schon allein, um ihre Mutter zu schonen, aber was ihr Vater eben zu Freddie gesagt hatte, war einfach zu viel – auch wenn sie sich nicht fragte, warum es sie derart auf die Palme brachte, denn eigentlich hatte ihr Vater nur die Wahrheit gesagt: Freddy gehörte nicht mehr zur Familie. Dafür hatte sie selbst gesorgt. Sie wandte sich an ihre Mutter: »Ich glaube, Dad hat dir etwas zu sagen, etwas über ihn und Vivienne Tully.«
»Das ist mir nicht entgangen, Manette«, sagte Valerie. »Freddie, stell die Zahlungen sofort ein. Nimm Kontakt zu ihr über die Bank auf, an die die Zahlungen gehen. Die sollen sie davon in Kenntnis setzen, dass ich das entschieden habe.«
Bernard sagte: »Das ist nicht …«
»Es interessiert mich nicht, was es ist und was nicht«, schnitt Valerie ihm das Wort ab. »Und dich sollte es ebenso wenig interessieren. Oder möchtest du mir gern erklären, warum du die Zahlungen gern fortsetzen würdest?«
Bernard wirkte gequält. Unter anderen Umständen hätte sie Mitleid mit ihm gehabt, dachte Manette. Aber Männer waren doch wirklich verdammte Mistkerle. Sie wartete darauf, dass ihr Vater versuchen würde, sich aus der Situation herauszulügen in der Hoffnung, dass sie nichts über ihr Gespräch verraten würde, in dem er ihr seine Affäre mit Vivienne Tully gestanden hatte.
Aber wie immer hatte Bernard Fairclough das Glück auf seiner Seite. Denn in dem Augenblick ging die Tür auf, und der Wind fegte herein. Als Manette sich umdrehte, weil sie glaubte, sie und Freddie hätten die Tür nicht richtig zugemacht, stürmte ihr Bruder Nicholas in die Eingangshalle.
LANCASTER – LANCASHIRE
Deborah sagte sich, dass sie unbedingt mit der Frau sprechen musste, die in Alateas Begleitung war. Denn wenn sie richtiglag mit ihrer Vermutung, dass alles mit Alateas Schwierigkeiten tun hatte, ein Kind zu bekommen, dann würde Alatea garantiert nicht gerne darüber reden wollen. Vor allem nicht mit einer Frau, die ihr die Unwahrheit über den Grund ihres Aufenthalts in Cumbria gesagt hatte. Und ebenso wenig würde Alatea einem Klatschreporter ihr Herz ausschütten. Wenn sie also den Grund für Alateas merkwürdiges Verhalten herausfinden wollten, dann mussten sie sich an Alateas Begleiterin halten.
Sie rief Zed auf dem Handy an.
»Das wird aber auch höchste Zeit«, fauchte er. »Wo zum Teufel stecken Sie? Was ist los? Wir haben eine Abmachung, und wenn Sie …«
»Sie sind in eins der Gebäude gegangen«, sagte sie.
»Na, das hilft uns ja enorm viel weiter«, schnaubte er. »Wahrscheinlich nimmt sie einfach an irgendeinem Seminar teil. Zusammen mit ihrer Freundin.«
»Ich muss mit ihr reden, Zed.«
»Ach, ich dachte, das hätten Sie bereits vergeblich versucht.«
»Ich rede nicht von Alatea. Die wird ebenso wenig mit mir reden wie mit Ihnen. Ich meine die Frau, mit der sie aus dem Invalidenheim gekommen ist. Mit der will ich reden.«
»Wieso?«
Jetzt wurde es kompliziert. »Die beiden scheinen sich ganz gut zu kennen. Sie haben sich auf dem ganzen Weg ziemlich angeregt unterhalten. Sie wirkten wie Freundinnen, und Freundinnen vertrauen einander Geheimnisse an.«
»Und Freundinnen wissen ein Geheimnis zu hüten.«
»Natürlich. Aber ich habe schon öfter festgestellt, dass die Leute außerhalb von London einen Heidenrespekt vor Scotland Yard haben. Hier draußen braucht man nur mit dem Dienstausweis zu wedeln, und schon sind die Leute bereit, einem ihre Geheimnisse zu offenbaren.«
»Dasselbe gilt für Reporter«, bemerkte Zed.
Sollte das ein Scherz sein?, fragte sich Deborah. Wahrscheinlich nicht. »Verstehe«, sagte sie.
»Dann …«
»Ich glaube, ich allein wirke weniger bedrohlich.«
»Inwiefern?«
»Das ist doch klar. Erstens wären wir in der Überzahl: zwei Fremde, die eine Frau auf ihre Freundschaft mit einer anderen Frau ansprechen. Zweitens … Also, Sie müssen schon zugeben, Zed, dass Sie mit
Weitere Kostenlose Bücher