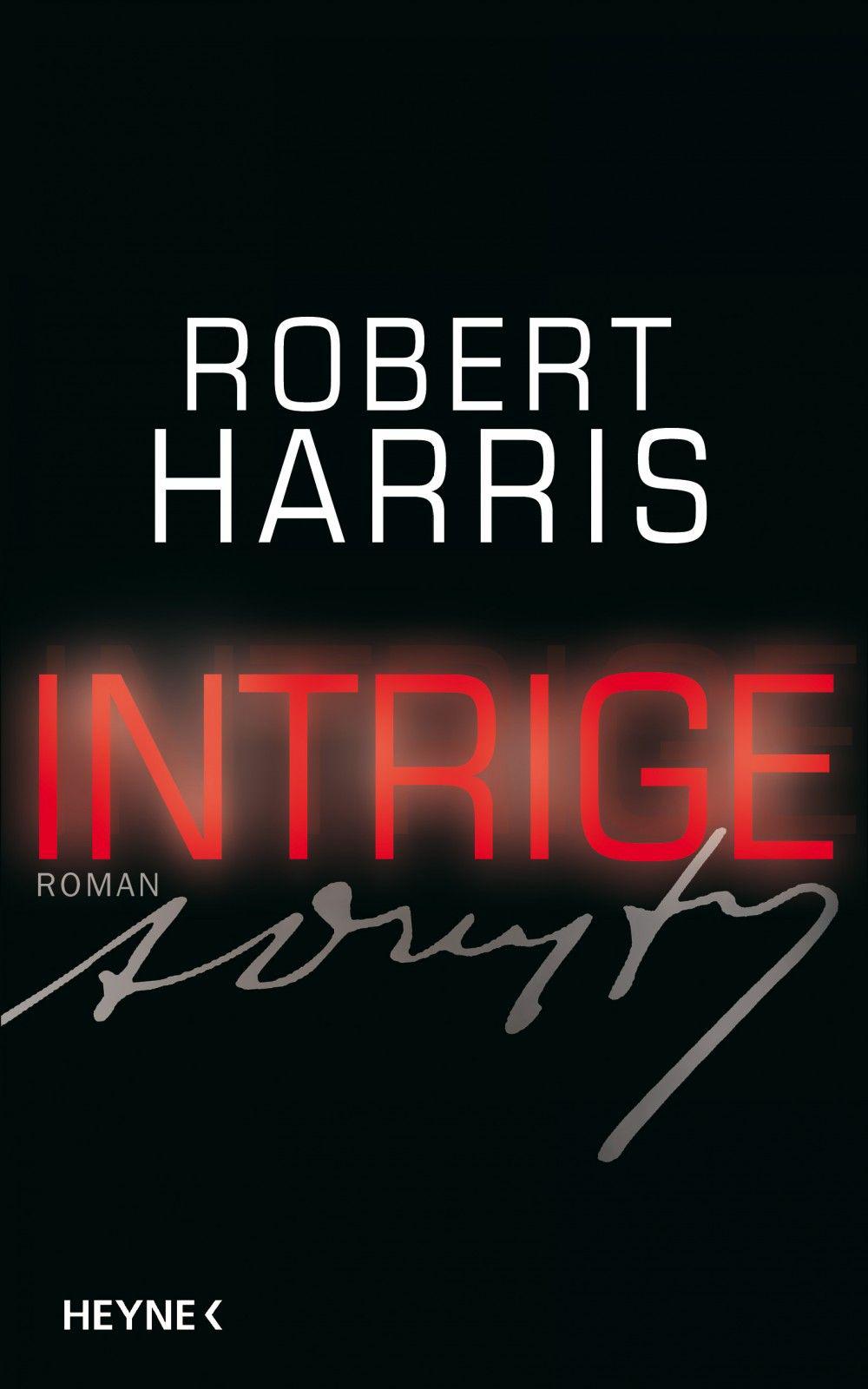![Intrige (German Edition)]()
Intrige (German Edition)
wie man will, und hineinlesen, was man will. Aber ich bezweifele, dass auch nur zwanzig Zeilen davon sich unmittelbar auf Dreyfus beziehen.«
Wir stehen etwas abseits von den anderen und rauchen eine Zigarette. Es dämmert. Hinter uns Gelächter. Jaurès’ Stimme, die die Natur für ein Publikum von zehntausend erschaffen hat, dröhnt durch den Garten.
»Wir werden beobachtet«, sagt Labori plötzlich.
Auf der anderen Straßenseite, in einem der Fenster im ersten Stock, ist deutlich Mercier zu erkennen. Er blickt in unsere Richtung.
»Seine alten Kameraden waren gerade zum Abendessen bei ihm«, sage ich. »Boisdeffre, Gonse, Pellieux und Billot gehen ständig ein und aus.«
»Es heißt, er will für den Senat kandidieren. Dieser Prozess ist eine großartige Bühne. Ohne seinen politischen Ehrgeiz stünde die andere Seite ohne jede Führung da.«
»Ohne seinen politischen Ehrgeiz wäre diese ganze Geschichte vielleicht nie passiert«, sage ich. »Er hat geglaubt, dass ihn die Dreyfus-Affäre bis ins Präsidentenamt spült.«
»Das glaubt er immer noch.«
•
Merciers Aussage ist für Samstag angesetzt – der erste Tag nach der Eröffnungssitzung, an dem Presse und Zuschauer wieder zugelassen sind. Sein Auftritt wird mit fast genauso viel Spannung erwartet wie der von Dreyfus. Er betritt den Gerichtssaal in der vollen Paradeuniform eines Generals – roter Rock, schwarze Hose, Mütze in Purpurrot und Gold. An seiner Brust funkelt der Orden des Großoffiziers der Ehrenlegion. Als er aufgerufen wird, erhebt er sich von seinem Platz im Kreise der Zeugen für die Armee und geht mit einer Dokumentenmappe aus schwarzem Leder nach vorn. Er bleibt keine zwei Meter neben dem Stuhl stehen, auf dem Dreyfus sitzt, würdigt diesen aber keines Blickes.
»Meine Aussage wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen«, sagt er mit leiser, rauer Stimme.
»Gerichtsdiener, einen Stuhl für den General«, sagt Jouaust salbungsvoll.
Mercier spricht drei Stunden lang, wobei er ein Dokument nach dem anderen aus der Mappe zieht. Darunter auch den Lump-D-Brief, den er hartnäckig mit Dreyfus in Verbindung bringt, und sogar die erfundenen Berichte von Guénée über einen Spion im Geheimdienst, auch wenn er den Namen der Quelle, Val Carlos, nicht erwähnt. Er übergibt die Schriftstücke Jouaust, der sie an seine Richterkollegen weiterreicht. Nach einiger Zeit lehnt sich Labori zurück und verrenkt den Hals, um mich anzusehen. Was tut der Idiot da, scheint sein fragender Gesichtsausdruck mir sagen zu wollen. Ich achte peinlich darauf, ein gleichgültiges Gesicht zu machen, aber ich denke das Gleiche. Indem er das Geheimdossier als Beweis vorlegt, bietet er Labori eine gefährlich offene Flanke für dessen Kreuzverhör.
Wie ein paranoider, ignoranter Leitartikler von La Libre Parole, der überall jüdische Verschwörungen wittert, schwadroniert Mercier vor sich hin. Er behauptet, aus England und Deutschland seien fünfunddreißig Millionen Francs geflossen, um Dreyfus’ Freilassung zu betreiben. Er zitiert, als ob es sich dabei um Tatsachen handelte, was Dreyfus angeblich über die Besetzung von Elsass-Lothringen gesagt und immer wieder abgestritten habe: »Wir Juden denken anders darüber. Wo wir sind, da ist unser Gott.« Er zerrt wie der den alten Mythos von seinem Geständnis vor der Degradierung heraus. Er versteigt sich zu einer fantastischen Erklärung, warum er den Richtern des Kriegsprozesses das Geheimdossier gezeigt habe, und behauptet, dass das Land wegen der Dreyfus-Kontroverse nur zwei Finger breit von einem Krieg mit Deutschland entfernt gewesen sei. Deshalb habe er General Boisdeffre die Anweisung gegeben, sich bereitzuhalten, um gegebenenfalls die volle Mobilmachung befehlen zu können, während er, Mercier, mit Präsident Casimir-Perier im Élysée-Palast bis halb ein Uhr nachts gewartet habe, ob der deutsche Kaiser einen Rückzieher machen würde.
Casimir-Perier, der auf der Zeugenbank sitzt, steht auf, um dieser Lüge zu widersprechen, und als Jouaust ihm das Wort verweigert, schüttelt er nur den Kopf über diesen Unsinn, was für gewaltiges Aufsehen im Saal sorgt.
Mercier ignoriert ihn und redet weiter. Es ist die alte Paranoia gegenüber Deutschland, der anhaltende Gestank des Defätismus nach 1 8 7 0. »Wäre für uns zu diesem Zeitpunkt ein Krieg erstrebenswert gewesen?«, fragt er. »Hätte ich als Kriegsminister unter diesen Umständen einen Krieg für mein Land anstreben sollen? Meine Antwort war klar:
Weitere Kostenlose Bücher