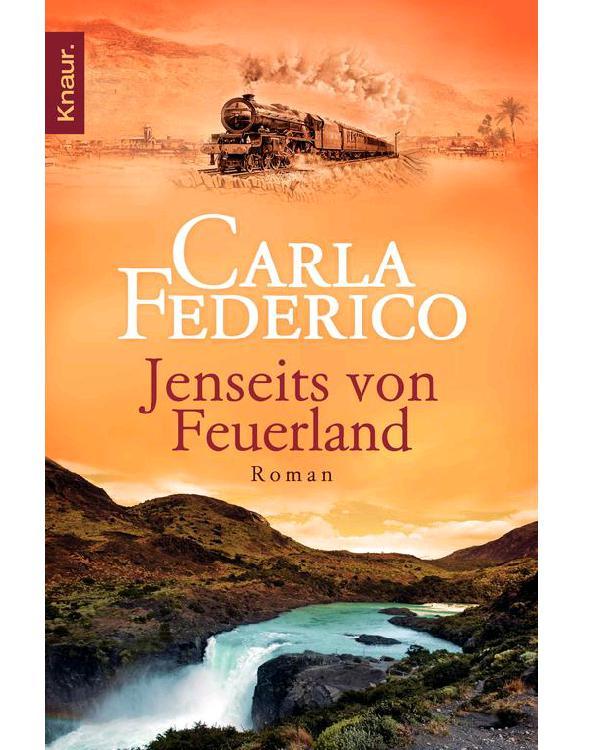![Jenseits von Feuerland: Roman]()
Jenseits von Feuerland: Roman
Robinson der Jüngere von Campe, das ist eine sehr spannende Geschichte.«
Sie sprach ohne Pause und schien sich gar nicht darum zu kümmern, ob die Mapuche-Frau ihr zuhörte und sie verstand. Doch genau das führte dazu, dass diese sich deutlich entspannte.
Gut … es war alles gut. Emilia würde nicht zulassen, dass ihr Böses geschah. Sie war in Sicherheit.
Als Emilia aus dem Buch vorzulesen begann, konnte die Mapuche-Frau auch an den jungen Mann denken, den Mann, der Manuel hieß, ohne vor Angst zu erschaudern. Er war zwar so groß wie die Soldaten, und seine Schultern waren ebenso breit. Aber er hatte nicht so böse gelacht wie sie. Eigentlich war er sogar ziemlich gutaussehend, mit diesen braunen Augen und den rötlich braunen Locken. Wie alt er wohl war? So alt wie sie und Emilia?
Während Emilia weiter vorlas, dachte sie an die Männer ihres Stammes, Männer mit langen, glänzenden Haaren und kohlschwarzen Augen, Männer, die ihr Gesicht mit der Farbe bemalten, die ihre Großmutter hergestellt hatte. Es hätte nicht mehr lange gedauert, dann wäre sie die Frau von solch einem Mann geworden. Sowohl ihre Großmutter als auch ihr Vater hatten befunden, dass sie nun alt genug dafür wäre.
Aber daran wollte sie nicht denken. Daran durfte sie nicht denken. Nicht an ihren Vater, nicht an ihre Großmutter, nicht an Bruder Franz. Sie würde weinen, wenn sie daran dachte, und sterben, wenn sie zu lange weinte.
Emilia hörte zu lesen auf und ließ das Buch sinken. »Was hast du denn?«, fragte sie.
Hatte sie etwa aufgeschluchzt?
»Nicht aufhören!«, schrie die Mapuche-Frau panisch und ohne darüber nachzudenken, was sie da sagte. »Hör nicht auf zu lesen!«
Emilia riss verwundert die Augen auf. »Du sprichst ja endlich wieder. Und du kannst sogar sehr gut Deutsch!«
»Ja … ja …« Das Reden fiel ihr schwer nach all der Zeit, aber ihre Kehle fühlte sich nicht mehr wie verdorrt an. Die Worte drängten aus ihr heraus – Worte und all die Erinnerungen. Sie wollte sie ausspeien wie verdorbenes Essen, um ihnen danach nie wieder Einlass zu gewähren.
»Ja … ja … mein Vater … er wollte, dass ich es lerne … natürlich auch Mapudungun … und Spanisch. Aber eben auch Deutsch. Er sagte, dass die deutschen Siedler gute Menschen sind. Wenn ich in Gefahr wäre, sagte er, soll ich zu Cornelius gehen. Cornelius Suckow …«
Emilia sprang vom Schaukelstuhl hoch. »Cornelius ist mein Vater!«, rief sie aufgeregt.
Die Mapuche-Frau schluchzte abermals auf, obwohl sie es eigentlich unterdrücken wollte. »Ihr beschützt mich, nicht wahr? Ihr alle beschützt mich!«
Emilia setzte sich an den Rand des Bettes und streichelte über ihr Gesicht. »Willst du mir erzählen, was passiert ist?«
Die Mapuche-Frau zuckte zusammen. »Tot«, stieß sie nur mit Mühen aus. »Alle sind tot … Alle, die in der Mission lebten.«
»Der Mission?«
Das Gesicht von Bruder Franz stieg vor ihr auf, wie er den Soldaten das Kreuz entgegengehalten hatte, bereit, das Leben der Mapuche mit seinem eigenen zu schützen.
Sie deutete auf das Buch. »Ich habe auch lesen und schreiben gelernt«, murmelte sie. »Von … von …« Sie konnte den Namen von Pater Franz nicht aussprechen. Sie durfte es nicht. »Wir … wir hatten Gebetsbücher«, sagte sie stattdessen. »Jeden Sonntag musste ein anderer daraus vorlesen und …«
Ihre Stimme versagte.
Emilia streichelte über ihre Schultern. »Es ist gut. Es ist alles gut. Hier kann dir niemand etwas antun. Wie … wie heißt du eigentlich?«
Diese Frage hatte sie am meisten gefürchtet. Die Mapuche-Frau glaubte zu ersticken, so heftig schluckte sie gegen das Weinen an. Doch irgendwie gelang es ihr, dass keine Tränen mehr aus den Augen quollen. »Ich weiß es nicht«, sagte sie, und das Bild von Bruder Franz verblasste, verblasste wie das Gesicht ihres Vaters, ihrer Großmutter. »Ich weiß es nicht mehr. Ich habe meinen Namen vergessen … und ich wünschte, ich könnte auch alles andere vergessen … könnte vergessen, wie …«
Wieder brach ihr die Stimme.
Emilia stellte keine Fragen mehr. »Scht, scht«, machte sie beschwichtigend, dann zog sie ihren Kopf an ihre Brust, streichelte ihr über das dunkle, glatte Haar, und die Mapuche-Frau ließ sie gewähren.
Alles war gut. Alles würde gut bleiben, solange sie ihre Erinnerungen unterdrückte.
Weitere Tage vergingen. Mittlerweile waren der Mapuche-Frau nicht nur die Einrichtung, die Kleidung und das Essen der
Weitere Kostenlose Bücher