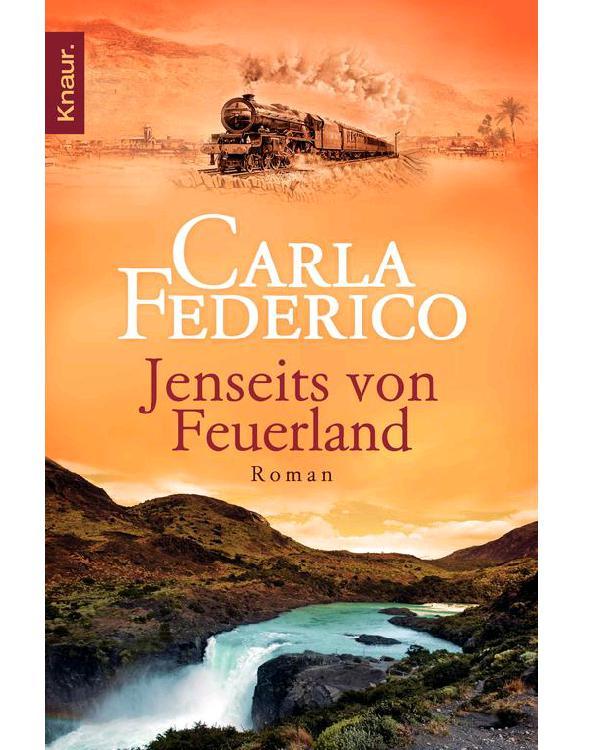![Jenseits von Feuerland: Roman]()
Jenseits von Feuerland: Roman
was ihr über die Lippen kam: »Jetzt, da ich ein Kind von dir erwarte.« Sie machte eine kurze Pause und schöpfte tief Atem, ehe sie fortfuhr. »An dem Tag, als die Cholera in unserem Varieté ausgebrochen ist, wurde mir beim Geruch der Milch übel. Hätte ich sie getrunken, ich wäre vielleicht krank geworden, doch ich trank sie nicht. Mir kam gar nicht in den Sinn, dass die Übelkeit von einer Schwangerschaft rühren könnte. Aber es ist so. Ich erwarte ein Kind von dir. Seit vier Monaten nun schon.« Sie ließ seine Hand kurz los, um sich aufzurichten. Dann beugte sie sich über ihn und nahm die Hand wieder, um sie auf ihren leicht gewölbten Leib zu ziehen.
»Ich dachte immer, ich könnte kein Kind kriegen, ja, ich dürfte es nicht … es wäre vielleicht krank an Leib und Seele … wegen meiner Eltern. Aber jetzt weiß ich, dass es richtig ist, dieses Kind zu bekommen, weil das Leben immer stärker ist als der Tod, und die Liebe immer stärker als der Hass. Also sei auch du stark und lebe! Für mich, Arthur, für mich und unser Kind! Lebe!«
Über Stunden kämpfte Arthur gegen den Tod, und mehr als einmal schien es, er würde diesen Kampf verlieren. Immer wieder ging sein Atem so flach, dass Emilia ihn kaum hören konnte und sie sich dicht über sein Gesicht beugen musste, um noch ein Lebenszeichen zu erhaschen. Sein Puls pochte entweder hektisch schnell oder so langsam, dass sie angstvolle Augenblicke lang das Gefühl hatte, er würde gleich aussetzen. Doch immer dann, wenn sämtliche Kräfte aus seinem Leib zu schwinden drohten, packte sie seine Hand und beschwor ihn. Sie sprach von sich und dass sie ohne ihn nicht weiterleben wollte, sie sprach von dem Kind, das ihn nicht minder brauchte als sie – und manchmal verfluchte sie ihn auch.
»Glaub nicht, du könntest dich einfach aus dem Staub machen!«, rief sie. »Mein Leben war einst zwar so viel leichter ohne dich, aber jetzt gibt es dich nun mal … und das Kind gibt es auch, also bleibst du!«
Sie schrie ihn an oder sprach mit raunender Stimme, sie bettelte, flehte oder beschimpfte ihn. Einmal stiegen ihr Tränen hoch, aber sie schluckte sie, weil sie das Zeichen von Hoffnungslosigkeit gar nicht zulassen wollte. Und irgendwann, nach vielen Stunden, da sie die Augen kaum mehr offen halten konnte, wurde der bläuliche Ton seines Gesichts etwas blasser. Er sah immer noch krank aus, die Haut war grau, die Furchen auf den Wangen tief, doch die Augen versanken nicht mehr vollends in Schlitzen. Er schlug sie auf, und als sich ihre Blicke trafen – der seine nicht länger von Krankheit getrübt, sondern erstaunlich wach –, konnte sie sich nicht länger beherrschen und schluchzte auf. Allerdings – kaum war ihr der verräterische Laut entkommen, der alle Sorgen, alle Ängste verriet und auch die Erleichterung, dass es ihm besserging, ließ sie seine Hand los und stand rasch auf.
»Emilia …«
Seine Stimme klang gebrochen und hielt sie zurück. Als sie auf ihn hinabblickte, ging ihr zum ersten Mal auf, wie viel Gewicht er verloren hatte. Ein großer, stattlicher Mann war er eigentlich, doch auf diesem hellen Laken wirkte er winzig und verloren.
Langsam ließ sie sich wieder an seinem Bett nieder.
»Emilia, lebe ich noch? Das kann doch gar nicht sein. Sonst wärst du schließlich nicht hier bei mir …«
»Glaub mir«, sagte sie rasch und wie üblich schroff, »der Himmel würde dir schnell zur Hölle, wenn ich der einzige Engel wäre, der dir auf deiner Wolke Gesellschaft leistet.«
»Egal, ob Himmel oder Hölle – Hauptsache, du bist da«, stammelte er. Mit jedem Wort wirkte er etwas kräftiger.
Sie streichelte zärtlich über sein Gesicht, obwohl ihre Stimme weiterhin hart und kalt klang: »Wir sind aber weder im Himmel noch in der Hölle, sondern auf Erden. Und gerade frage ich mich, warum dir die Cholera nicht wenigstens die Süßholzraspelei ausgetrieben hat. Dann hätte sie was Gutes gehabt.«
»Das einzig Gute wäre, wenn du mir verzeihen würdest.«
Er versuchte, sich aufzurichten, schaffte es aber nicht. Wahrscheinlich würden noch viele Tage vergehen, bis sein Körper stark genug war, um wieder zu sitzen, ja, gar zu stehen. Emilia ahnte, dass dies eine bittere Erfahrung für ihn sein musste, und sie konnte sich die Schadenfreude nicht ganz verkneifen. Im nächsten Augenblick aber nahm sie ein Essigtuch, um ihm vorsichtig über die Stirn zu wischen.
Obwohl sie seine Worte nicht erwiderte, lächelte er plötzlich.
»Du
Weitere Kostenlose Bücher