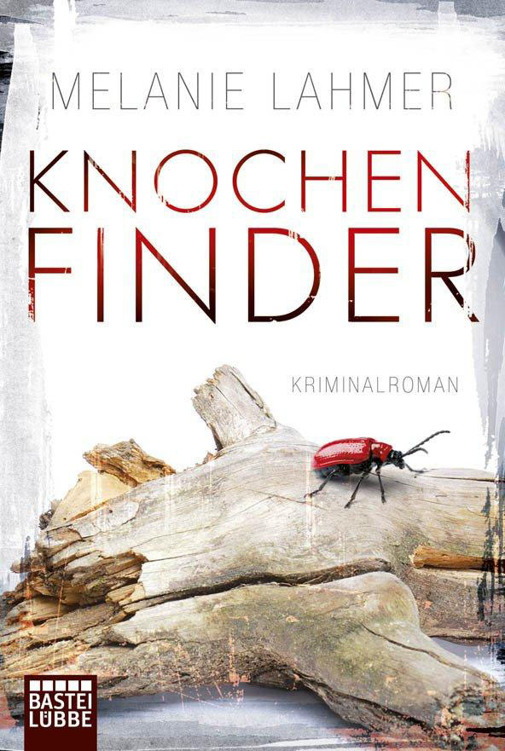![Knochenfinder]()
Knochenfinder
wollte. Timo lief nun voraus und blickte sich suchend um. Dann blieb er stehen.
»Ich seh ihn!«, rief er. »Dahinten ist ein Grenzstein. Siehst du ihn?«
»Hmm«, brummte Jonas zustimmend, während er tief Luft holte und den Anblick der Lichtung genoss. »Geh ruhig schon vor, ich komm gleich nach.«
Sollte Timo doch allein an dem verwitterten Stein herumstochern und die Dose finden; er würde sich später trotzdem ins Logbuch eintragen. Aber jetzt brauchte er erst mal eine kurze Verschnaufpause. Mit den Händen stützte er sich auf den Knien ab und schloss die Augen. Es war wunderbar still, nur ein paar Grillen zirpten irgendwo in der Nähe. Ab und an knackte es; allerdings konnte er nicht erkennen, woher die Geräusche kamen.
Urplötzlich hörte er einen Schrei, der vage an Timos Stimme erinnerte.
Jonas richtete sich auf. »Was ist los? Ist dir was passiert?«
Er lief zum Grenzstein, wo sein Mitbewohner reglos wie eine Vogelscheuche vor einem üppigen Holunderstrauch stand, den Mund weit aufgerissen.
»Da!« Mit zitternden Fingern zeigte Timo auf den Boden. Er drehte leicht den Kopf, sein Blick schien durch Jonas hindurchzugehen.
Jonas schaute nach unten. Stöckchen und kleine Steine lagen neben Timos Fuß – und eine Brotdose ohne Deckel. Jonas ging in die Hocke und sah in die Dose hinein. Kleinkram lag darin: ein Schlüsselanhänger, ein Notizblock mit Bleistift, ein Flaschenöffner ... Das übliche Zeug. Alles war ein wenig schmutzig; getrocknete Grashalme und kleine Dreckklumpen lagen ebenfalls im Behälter. So wie in jeder Cachedose. Dazu eine Geocoin, eine Münze zum Weitergeben.
Und dann sah er es auch.
»Was ist denn das?« Seine Frage schrillte in den Ohren. Die eigene Stimme kam ihm unvertraut vor; sie klang viel zu hoch.
»Sieht aus wie ein Knochen«, presste Timo durch zusammengebissene Zähne hervor.
Kapitel 10
Verärgert warf Natascha ihren Kugelschreiber auf einen Haufen Computerausdrucke. In den letzten drei Stunden war sie ausschließlich damit beschäftigt gewesen, das Internet und die polizeiinternen Datenbanken nach Hinweisen auf René Staudt abzusuchen. Doch das hatte nur wenige Ergebnisse gebracht. Als Zehnjähriger war er Dritter beim Gau-Kinderturnfest gewesen und in der siebten Klasse zusammen mit zwei Klassenkameraden als Schülerreporter bei der Kreiszeitung. Und in den internen Datenbanken tauchte er überhaupt nicht auf: kein Hinweis auf irgendwelche Straftaten, kein Ladendiebstahl, keine Prügelei, keine Drogengeschichten – es war nicht einmal dokumentiert, dass er schon einmal weggelaufen war. Ob er Kontakt zu den Jugendlichen vom Bahnhofsplatz hatte oder gar dazugehörte, hatte sie ebenfalls nicht in Erfahrung bringen können. Er wurde weder mit einer linken noch mit einer rechten Gruppierung in Zusammenhang gebracht, schien nicht zu den Ultras eines Fußballclubs zu gehören und erregte auch sonst kein Aufsehen. Statt schneller Ergebnisse stand am Ende ihrer Computer-Recherche nur ein riesengroßes Fragezeichen. René Staudt schien ein ganz normaler Gymnasiast aus einer typischen Mittelschichtfamilie zu sein, der nichts Besonderes oder gar Auffälliges an sich hatte. Wie konnte man nur so durchschnittlich sein?
Aber was wusste sie schon von den Menschen in typischen Mittelschichtfamilien? Als Tochter einer alleinerziehenden Krankenschwester hatte sie früh gelernt, dass es zwei Klassen von Kindern gab: die mit Vater und Geld – und die ohne. Das Leben in einer sogenannten Durchschnittsfamilie hatte sie nie kennengelernt.
Natascha nahm weitere Ausdrucke aus dem Schacht des Druckers und legte dann alle in die Mappe für Lorenz. Wenn schon über den Computer nichts zu finden war, gab es ja vielleicht neue Hinweise aus der Bevölkerung. Sie hatten das Foto von René mit einer Vermisstenmeldung an alle Zeitungen geschickt, auch an die kostenlosen. In den Online-Ausgaben waren Bild und Text längst erschienen, das hatte sie schon überprüft. Auch auf der Polizeihomepage prangte Renés Foto.
Ob bei Winterberg schon Meldungen aus der Bevölkerung eingegangen waren? Natascha musste das unbedingt wissen. Sie entschied, nicht bis zur Besprechung zu warten, die Winterberg für vierzehn Uhr angesetzt hatte, und marschierte schnurstracks zu seinem Büro.
Natascha klopfte an den Rahmen der Tür, die wie immer weit offen stand. Winterberg, der hinter seinem Schreibtisch saß und gerade telefonierte, blickte zu ihr. Mit dem Kugelschreiber in der Linken wies er auf den
Weitere Kostenlose Bücher