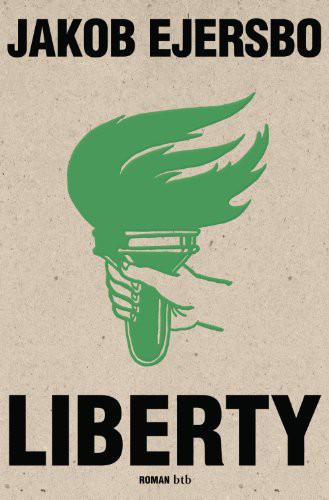![Liberty: Roman]()
Liberty: Roman
Richtung schreien. Ich humpele auf die Straße. Sehe Rachel allein auf der anderen Seite stehen, höre, wie Tito und der andere weglaufen. Abdullah kommt gemächlich schlendernd zurück. Rachel schluchzt. Ich gehe zu ihr. Spucke, atme schwer, habe Bauchschmerzen.
»Sag mir, wer die sind. Worum geht’s hier?«
»Entschuldigung«, sagt Rachel. »Das ist ein großes Problem.« Abdullah steht direkt neben uns.
»Danke, Abdullah«, sage ich. »Wir kommen gleich, warte einfach an der Tür.« Er dreht sich um und geht. Ich stehe vor einer Hure. Meiner Hure. Und sie weint und schaut mich flehend an. Mir ist übel. Sie hat … mein Kopf pulsiert nach dem Schlag, es klopft an den Schläfen. Und sie hat für Geld gepumpt. Für Tito. Sie hat bestimmt auch Tito gepumpt. Und alle möglichen mabwana makubwa – für Geld. Marcus hat es gewusst. Vielleicht hat es auch Rogarth gewusst. Und Abdullah und Khalid und Ibrahim.
»Mach dir um diese Typen keine Sorgen«, sagt Abdullah. »Ich rede mit Big Man Ibrahim. Wir sagen denen, sie sollen dich in Ruhe lassen, damit wir unsere Geschäfte machen können.« Mir gefällt nicht, dass er »unsere« Geschäfte sagt, aber im Augenblick ist nicht der Moment, um so etwas zu diskutieren. »Ich kenne viele Typen, die für ein bisschen Geld alles Mögliche machen würden«, fügt Abdullah hinzu. Rogarth schleppt die Anlage in ein Taxi.
»Du fährst mit mir«, sage ich zu ihm.
»Okay.«
»Sollen wir dich irgendwo absetzen?«, frage ich Abdullah.
»Nein, ich werde laufen. Die Nacht hat Angst vor mir«, behauptet er lachend. Ich lächele ihm angestrengt zu.
»Rachel!«, rufe ich. »Ins Auto!« Sie springt auf den Rücksitz neben Rogarth. Ich sitze auf dem Beifahrersitz. Auf dem Rückweg sagt niemand von uns ein Wort. Am Haus steigt sie aus dem Wagen, bleibt aber auf dem Hof stehen, die Arme um sich geschlungen. Rogarth und ich tragen die Anlage hinein. Das Taxi fährt. »Geh rein«, fordere ich Rachel auf. Sie gehorcht. »Warte hier draußen, Rogarth.« Ich gehe ihr nach. Mir ist es egal, ob er uns hören kann. Dann weiß er wenigstens, worum es geht, wenn ich gleich mit ihm rede. Rachel steht im Wohnzimmer, gleich neben der Eingangstür, noch immer die Arme um sich geschlungen.
»Entschuldige, Christian«, flüstert sie und schnieft.
»Setz dich.« Ich zeige aufs Sofa. Sie setzt sich mit fest zusammengeklemmten Beinen auf die Kante, die Hände im Schoß gefaltet. Es wirkt absurd – ein bisschen spät, um züchtig zu sein.
»Ich weiß jetzt alles über dich«, sage ich und setze mich in den Stuhl ihr gegenüber. »Aber du musst es mir erzählen, damit ich erlebe, wie du mich – zum ersten Mal – nicht anlügst.«
»Nein, Christian«, flüstert sie.
»Sonst schmeiße ich dich sofort auf die Straße!«
» Aaaiiiihhh .« Rachel heult, steht auf, geht in eine Ecke, bleibt stehen und schaut auf die Wand, dann auf den Boden. Atmet schwer. Sie flüstert nicht mehr, jetzt spricht sie: »Was sollte ich denn machen? Vor Hunger sterben? Ich muss leben. Ich habe ein Kind. Das Kind muss leben.«
»Wie lange hast du die mabwana makubwa für Geld gepumpt?«
»Meine Tochter Halima war krank geworden, also musste ich Geld für die Medizin ins Dorf schicken – sonst hätte sie sterben können«, erklärt Rachel. Sie sollte auf die Frage antworten, ich wollte sie demütigen, aber ich bin froh, dass sie nicht geantwortet hat. Ich will es nicht hören. Ich bekomme einen schlechten Geschmack im Mund, wenn ich die tansanischen Slangausdrücke benutze, denn ich habe … noch heute Morgen ihre Möse geschmeckt. Ich bin ein Narr. Ich habe es auch nicht wissen wollen, weil … ich sie wollte.
»Möglicherweise trägst du Krankheiten in deiner kuma , nachdem dich so viele ohne Socke gepumpt haben.« Ich merke, wie Marcus aus meinem Mund spricht.
»Ich habe keine Krankheiten. Ich habe aufgepasst.«
»Vielleicht hat Faizal dich angesteckt, als er dich dick gemacht hat.«
»Nein, Halima ist gesund.«
»Hast du unsaubere Männer gepumpt?«
»Nein«, erwidert sie und lässt sich die Wand hinuntergleiten, bis sie mit angezogenen Beinen auf dem Boden sitzt. Ich sitze auf der Sesselkante. Sie blickt mich aus vollkommen erloschenen Augen an – müde. Rogarth sitzt draußen auf der Veranda.
»Und was jetzt?«, sage ich. Sie fragt nicht, ob sie gehen soll. Wenn ich sage, sie soll gehen, würde sie es sofort tun, ohne ein Wort zu sagen. So ist es. Sie ist Afrikanerin. Wenn ich nichts sage, wird sie, wenn es
Weitere Kostenlose Bücher