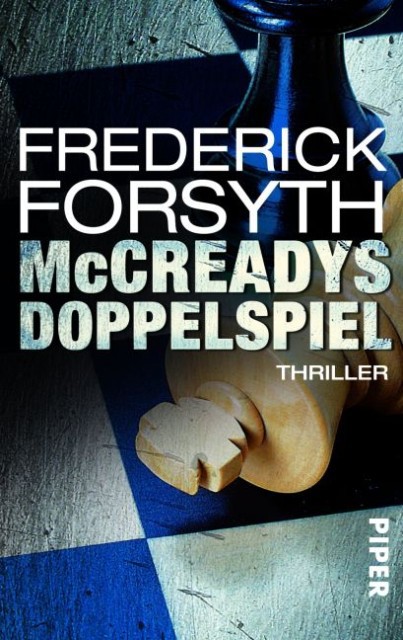![McCreadys Doppelspiel]()
McCreadys Doppelspiel
auf einen Mann mit grauem Haar und rheinländischem Akzent zu konzentrieren, der versuchte, aus dem Ring hinauszukommen, nicht auf einen stinkenden Traktor, der von außen hinein wollte. Der Traktor fuhr weiter und bog dann, fünf Kilometer vor Weimar, auf einen Feldweg ab. McCready sprang vom Anhänger, zog das Fahrrad herunter, winkte dem alten Bauern dankend zu und radelte weiter in Richtung Weimar.
In der Stadt hielt er sich dicht am Randstein, um den Lastwagen auszuweichen, die Soldaten in der grüngrauen Uniform der Nationalen Volksarmee absetzten. Dazwischen war gar nicht selten das hellere Grün der Uniformen der Volkspolizei zu sehen. Weimarer Bürger versammelten sich in Gruppen neugierig an Straßenecken. Jemand äußerte die Vermutung, es handle sich um ein Manöver; niemand widersprach. Manöver waren für das Militär etwas Normales - allerdings nicht gerade im Zentrum einer Stadt.
McCready hätte sich gern einen Stadtplan gekauft, konnte aber nicht riskieren, gesehen zu werden, wie er sich darin vertiefte. Er war ja kein Tourist. Er hatte sich auf dem Flug nach
Hannover seine Route anhand der von der Abteilung Ostdeutschland in London entliehenen Karte eingeprägt. Er kam auf der Erfurter Straße in die Stadt, fuhr geradeaus in Richtung auf das alte Zentrum und sah weiter vorne die Vorderfront des Nationalmuseums emporragen. Er bog auf dem Kopfsteinpflaster nach links in die Heinrich-Heine-Straße ein und fuhr Richtung Karl-Marx-Platz. Dort stieg er ab und begann mit gesenktem Kopf das Rad zu schieben, während in beiden Richtungen Fahrzeuge der Volkspolizei in raschem Tempo vorbeifuhren.
Am Rathenauplatz angekommen, hielt er nach der Brennerstraße Ausschau, die er dann am anderen Ende des Platzes entdeckte. Wenn ihn die Erinnerung nicht trog, mußte die Bockstraße nach rechts abbiegen. So war es. Die Nummer 14 war ein altes Haus, seit langem reparaturbedürftig, wie beinahe alles in Erich Honeckers Paradies. Farbe und Gips blätterten und bröckelten ab, und die Namen auf den acht Schildchen waren verblichen. Aber er erkannte doch an der Wohnung Nr. 3 den Namen Neumann. Er schob das Fahrrad durch das Haustor, lehnte es an die Wand und ging die Treppe hinauf. Auf jeder Etage gab es zwei Wohnungen. Er nahm die Mütze ab, zog seine Jacke zurecht und drückte auf den Klingelknopf. Es war zehn vor neun.
Eine Zeitlang regte sich nichts. Nach zwei Minuten war endlich ein Schlurfen zu hören, und die Tür öffnete sich langsam. Fräulein Neumann war eine hochbetagte weißhaarige Dame in einem schwarzen Kleid, die sich auf zwei Gehstöcke stützte. Sie blickte zu ihm hinauf und sagte: »Sie wünschen?«
Er lächelte breit, als hätte er sie wiedererkannt.
»Ja, Sie sind es, Fräulein Neumann. Sie haben sich zwar verändert, aber auch nicht mehr als ich. Sie werden sich nicht an mich erinnern. Martin Kroll. Sie haben mich in der Volksschule unterrichtet, vor vierzig Jahren.«
Ihre hellblauen Augen hinter den goldgeränderten Brillengläsern musterten ihn mit einem ruhigen, festen Blick.
»Ich bin zufällig nach Weimar gekommen. Aus Berlin. Ich wohne dort. Und ich habe mich gefragt, ob Sie noch hier leben. Sie standen im Telefonbuch. Und so hab ich es eben probiert. Darf ich eintreten?«
Sie trat beiseite, und er ging an ihr vorbei. In der dunklen Diele roch es modrig. Sie humpelte ihm auf ihren arthritischen Beinen voran in ihr Wohnzimmer, dessen Fenster auf die Straße gingen. Er wartete, bis sie Platz genommen hatte, und setzte sich dann auf einen Stuhl.
»So, ich habe Sie vor Jahren in der alten Volksschule in der Heinrich-Heine-Straße unterrichtet. Wann war das?«
»Tja, wohl 1943 oder 1944. Wir waren ausgebombt. Aus Berlin. Ich wurde zusammen mit anderen Kindern hierher evakuiert. Es muß im Sommer 1943 gewesen sein. Ich war in einer Klasse zusammen mit. ach, die Namen, doch, ich erinnere mich an Bruno Morenz. Er war mein bester Kumpel.«
Sie blickte ihn eine Weile eindringlich an und zog sich dann an ihren Stöcken hoch. Er stand ebenfalls auf. Sie humpelte an ein Fenster und blickte hinunter auf die Straße. Ein mit Vopos besetzter Lastwagen rumpelte vorbei. Sie saßen aufrecht da, in den Halftern an ihren Gürteln die ungarischen AP9-Pistolen.
»Immer die Uniformen«, sagte sie leise, als spräche sie zu sich selbst. »Erst die Nazis, jetzt die Kommunisten. Immer die Uniformen und die Revolver. Erst die Gestapo, jetzt der SSD. O Deutschland, womit haben wir die beiden verdient?«
Sie
Weitere Kostenlose Bücher