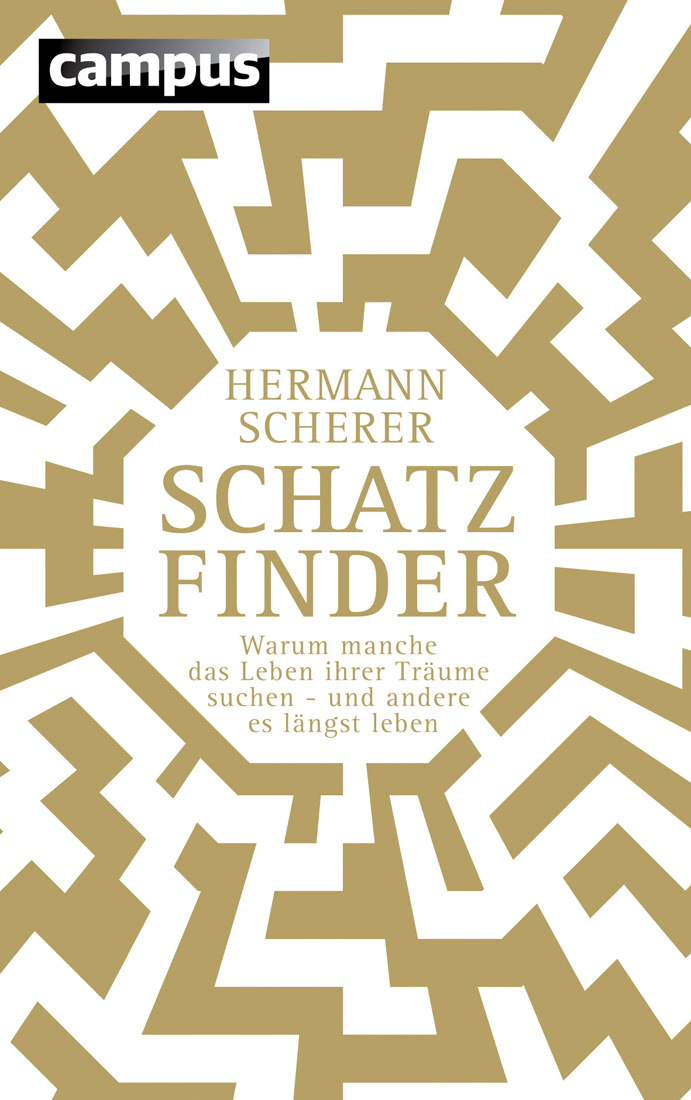![Schatzfinder]()
Schatzfinder
Diese Sorte Wahrheit ist gemeint, wenn man landläufig einfach sagt: Es ist so.
Die zweite Wahrheit ist die »Wir-Wahrheit«. Etwas passiert, und wir wohnen dem bei, zum Beispiel, wenn jemand Klavier spielt. Wir interpretieren dann das Erlebte und halten es gemeinsam für wahr. Wenn einer vor einem Ding mit schwarzen und weißen Stäbchen sitzt und darauf herumdrückt, was unterschiedliche Töne erzeugt, die in uns ein bestimmtes Gefühl von Stimmigkeit erzeugen, dann nennen wir das Klavierspielen. Dahinter liegen aber mehrfache Übereinkünfte und die Annahme gemeinsamer Erlebnisse. Außer den »Es-Wahrheiten«, dass ein Klavier ein Klavier ist, Tasten Tasten sind und ein Hocker ein Hocker ist, fügt sich die Wahrheit des Klavierspielens erst zusammen, wenn wir das innere Erlebnis der akustischen Stimmigkeit als Musik interpretieren und uns darauf einigen. Diese kollektiv-innere Übereinkunft kann von Kulturkreis zu Kulturkreis unterschiedlich sein, und es kann sich auch im Zeitverlauf ändern. Wer weiß, was wir in 100 Jahren als Musik bezeichnen?
Bis vor wenigen Jahrzehnten beispielsweise wurde wildes Herumgehaue auf dem Klavier mit zugehörigem Gegröle und Gezappel kollektiv nicht als Musik erlebt. Seit der amerikanische Discjockey Alan Freed 1951 im Radio den merkwürdigen Lärm einer Künstlerbewegung um Bill Haley, Chuck Berry, Bo Diddley und anderen als »Rock and Roll« bezeichnete, war daraus eine Musikrichtung geworden, eine neue »Wir-Wahrheit«. Wir-Wahrheiten stellen die Verbindung zwischen den Individuen und den Es-Wahrheiten her. Es sind gemeinsame, innere Übereinkünfte über die äußeren Erscheinungen und Handlungen: »Für uns sei es so.«
Die dritte Wahrheit ist die »Ich-Wahrheit«. Sie ist gemeint, wenn ich in mir und für mich eine Bewertung und Interpretation der Welt da draußen treffe. Wenn ich zum Beispiel sage, Zürich sei eine schöne Stadt, dann stimmt das auch – aber erst mal nur für mich. Viele Kritiker und Medien verwechseln Ich-Wahrheiten mit Es-Wahrheiten, wenn sie nämlich glauben, ihr subjektiver Eindruck sei eine verbindliche Übereinkunft mit allen anderen Menschen über eine Sache. Sie sagen oder schreiben dann »David Garrett spielt das Stück von Mozart zu langsam« – als ob es so sei. Dabei ist es nur eine einzelne Meinung, eine Interpretationdes Kritikers von Garretts Interpretation von Mozart. Er hat aber Garrett nicht gefragt, warum er das Stück so langsam spielt. Und keiner von beiden kann Mozart gefragt haben, ob das Stück so und nicht anders interpretiert werden sollte. Es ist wie mit der Rechtschreibreform: Es wird festgelegt und soll dann gelten.
Bei dieser Wahrheit braucht es also nichts außer einer individuellen Aussage: »Ich finde es so.« – Sie findet im Innern eines Individuums statt.
Jede Es-Wahrheit war einmal eine solche Ich-Wahrheit. Die anderen müssen ihr erst mal nicht folgen, solange es keine Übereinkunft gibt. Erst wenn Einverständnis darüber herrscht, dass Erdbeeren Erdbeeren sind, wird daraus eine Es-Wahrheit, was die Voraussetzung dafür ist, dass eine Kultur für sich als Wir-Wahrheit festlegen kann, dass der Juni der Erdbeermonat ist.
Wir wissen nie, ob wir den anderen verstanden haben, wir können es nur vermuten.
Das Problem mit der Übereinkunft ist, dass sie nicht wirklich auf der Wirklichkeit beruht. Wenn ich mit den anderen Menschen um mich herum übereinkunfte, dann weiß ich nicht, ob ich die Dinge wirklich richtig verstanden habe. Vielleicht habe ich sie nicht so verstanden, wie die anderen Menschen wollen, dass ich sie verstehe, vice versa. Ich kann dann eigentlich nur sagen, dass ich glaube, den anderen verstanden zu haben. Wir wissen es nie! Wir wissen nie, ob wir den anderen verstanden haben, wir können es nur vermuten.
Es gibt eine indianische Kultur am Amazonas, die lehnt generelle Übereinkünfte ab. In der Sprache der Pirahã-Indianer gibt es keine Wörter für Farben, für gestern, für Zahlen, für »danke« oder für »Entschuldigung«. Sie kennen auch keine Nebensätze, das heißt, sie verknüpfen niemals individuelle Behauptungen zu übereinkunfteten Wahrheiten. Der ehemalige Missionar David Everett schildert das in seinem Buch
Das glücklichste Volk der Welt
so: Aus »Der Mann hat ein Kanu« und »Der Mann fällt einen Baum« wird bei den Pirahã niemals »Der Mann, der ein Kanu hat, fällte einen Baum« – denn das ist schon jenseits ihrer Grenze der Spekulation.
Wegen der tief in ihnen
Weitere Kostenlose Bücher