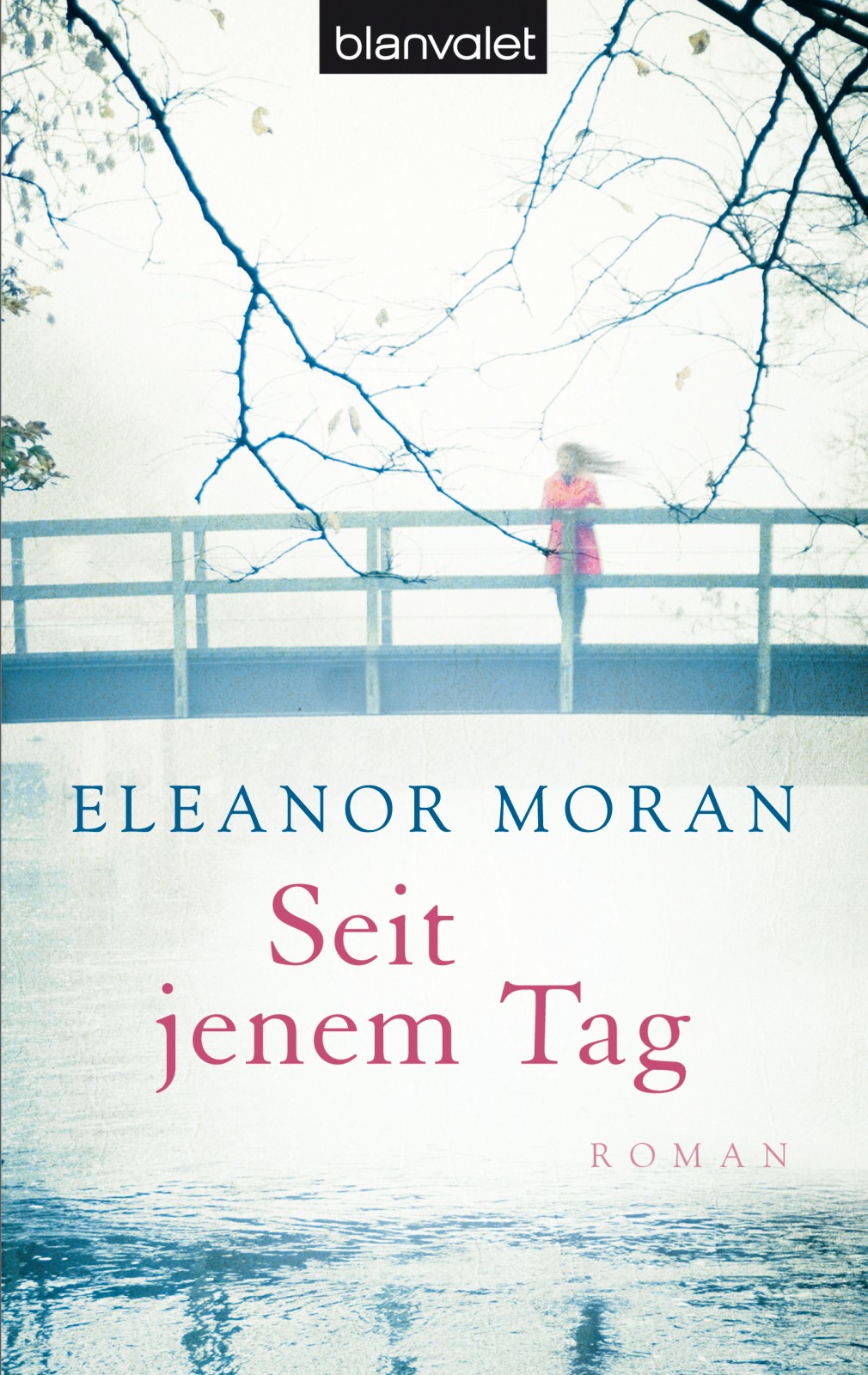![Seit jenem Tag]()
Seit jenem Tag
Schmuck und hole die Halsketten heraus, die dort ineinander verheddert liegen. Ich löse eine heraus und lege sie ab, bis das Samtfutter mir vorkommt wie ein Sarg. Ich schlucke die Übelkeit hinunter und möchte plötzlich nichts lieber, als davon und mit schlingerndem Herzen durch die Straßen hier zu laufen, bis ich ganz weit weg bin. Ich setze mich und ringe um Fassung.
Nach ein paar Minuten mache ich weiter und sortiere entschlossen weitere Kisten mit Pullovern, teuren Hosen und erstklassigen hochhackigen Schuhen aus, bis ich schließlich zu einer Kiste mit schweren Wintermänteln vorstoße, offenbar gekauft, um die frostigen New Yorker Winter auszuhalten. Ich ziehe jeden einzeln heraus und betrachte sie prüfend und stelle mir vor, was sie erlebt haben. Einer zieht mich an wie ein Schmuckstück eine Elster: Er ist rot, hat einen geschwungenen Kragen und auffällige schwarze Knöpfe, die vom runden Halsausschnitt nach unten führen. Auch ihm haftet der Duft von Chanel N° 19 an, und vielleicht verströmt er sogar noch den Geruch einer heimlich gerauchten Zigarette, jedenfalls treibt etwas mich an hineinzuschlüpfen, obwohl mir dabei leicht schwindelig wird. Ich drehe meinen Körper und spüre dabei sein exquisites Rascheln, dann gehe ich ins Bad, um mich dort im Spiegel zu betrachten, wobei ich fast damit rechne, Sallys Spiegelbild zu sehen. Wer warst du in diesem Mantel? Wohin hat er dich begleitet? Ohne es begründen zu können, verrät er mir, dass er unter all den anderen, die wie Ölsardinen in der Kiste liegen, ihr Lieblingsmantel war.
Während ich mich betrachte, spüre ich etwas Hartes in der Tasche, und meine Hand hält es fest. Ich ziehe es heraus: Es ist ein nummerierter Plastikchip mit der Aufschrift Capricorn Holdings. Er liegt auf meiner Hand, ohne dass ich die Bedeutung entschlüsseln könnte. Aber auf einmal kann ich den Mantel nicht schnell genug ausziehen, aus Angst, William könnte zurückkommen und mich darin sehen. Ich schiebe den Chip in meine Jeanstasche, weg vom Durcheinander der Kisten, mit der Absicht, sie ihm zu zeigen. Ich bin willens, mir die nächste Kiste vorzunehmen, fürchte allerdings, dadurch von meiner eigentlichen Aufgabe abgelenkt zu werden. Der Chip gräbt sich hart und spitz in meinen Oberschenkel, bis ich keine andere Wahl mehr habe und losgehe, um William zu suchen.
Draußen regnet es, der Rasen ist feucht und gibt unter meinen Füßen nach. Die Küchentür klemmt, und als ich an ihr rüttele, läuft mir der Regen in den Kragen. Ich rufe Williams Namen, bekomme jedoch keine Antwort. Schließlich gelingt es mir unter Schultereinsatz, ins Haus zu gelangen, aber dort ist alles still, bis auf das Ticken der alten Standuhr im Flur. Wo ist er? Ich gehe durch eine Tür rechts im Flur und befinde mich nun in einem dunklen Esszimmer mit hohen Holzstühlen, die wie Juroren, die einen Fall verhandeln, um einen Palisandertisch stehen. Neugierig inspiziere ich die Familienfotos, die am Sideboard aufgereiht sind, und mein Blick fällt auf ein Schulfoto von William im Alter von etwa zwölf Jahren in einem gestreiften Schuljackett mit einem großen Wappen, das Haar seitlich und im Nacken streng und sehr kurz geschnitten. Er blickt direkt in die Kamera, als würde er sich alle Mühe geben und liefern, was man von ihm verlangt. Die anderen Fotos streife ich nur – es sind die austauschbaren Bilder von kleinen Enkelkindern, die Hochzeitsfotos – Übergangsriten, die beweisen, dass man auf dieser Welt Spuren hinterlassen hat. Das Hochzeitsfoto seiner Eltern ist ein unvergesslicher Anblick: Sein Dad in einem makellosen Cut in steifer Haltung, der ernste Blick in die Ferne gerichtet, als wäre die hübsche lächelnde Braut, die seine Hand hält, gar nicht anwesend. Ich glaube nicht, dass auch nur ein einziges Foto davon nicht gestellt war.
Ich gehe in den Flur zurück und rufe Williams Namen, weil ich mich nicht traue, weitere Türen zu öffnen. Es kommt keine Antwort, nur das Ticken, das einen verrückt macht. Mich fröstelt wegen meiner feuchten Kleider, und ich bin irgendwo tief auf dem Land allein und erlebe meine ganz eigene Version von Kubricks Horrorfilm Shining.
»William!«, rufe ich laut und in schärferem Ton, wobei ich die irrationale Angst zu unterdrücken versuche, die wie ein langsam wirkendes Gift durch meine Adern kriecht.
Nach einer Pause höre ich das Knarren einer Tür.
»Hier«, ruft er mit gebrochener Stimme.
Ich bleibe wie festgewurzelt stehen und frage mich,
Weitere Kostenlose Bücher