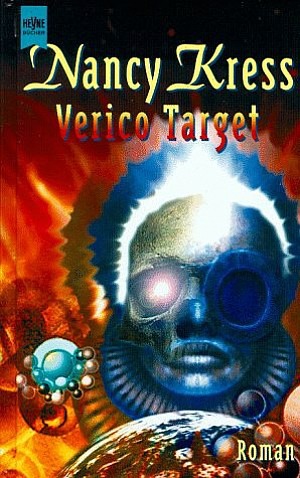![Verico Target]()
Verico Target
Oberfläche unseres Lebens zu blicken. Und
wir danken Dir für die schwierigste und mißverstandenste
Deiner Gaben, das Leid, ohne das wir nicht erkennen würden, wie
wenig wir verstehen. Das Leiden mag uns nicht immer wie eine Gabe
erscheinen, und doch…«
»Blödsinn«, sagte Judy.
Alle Augen wandten sich ihr zu – langsam und ruckweise, wie
eine schlecht geölte Maschine.
»Das ist alles Blödsinn! Alles! Das Leiden ist doch
keine gottverdammte Gabe!« Ihre Stimme war nach oben geklettert.
Matthew zog seine kleine warme Haus aus der ihren und setzte zum
Weinen an. Schräg gegenüber von Judy fiel Großtante
Patricia das Kinn herab wie warmer Teig. »Ihr sitzt hier,
fühlt euch sicher und geschützt und geliebt von irgendeinem
unsterblichen Arbeiterführer da oben im Himmel,
während… während draußen in der realen
Welt… während…«
Der Arm ihres Vaters legte sich um ihre Schultern und hob sie vom
Stuhl hoch. Wütend schüttelte sie ihn ab, aber sie folgte
ihm aus dem Eßzimmer in sein Arbeitszimmer. Hinter ihnen
herrschte absolute Stille. Die beiden Reihen von Gesichtern, diese
identischen, blassen Ovale, schienen keinerlei Bezug zu Judy zu
haben, und sie hatte den Eindruck, noch nie zuvor etwas so
Dümmliches gesehen zu haben wie diese Gesichter mit den fettigen
Lippen und den breiten irischen Schädeln, die nebeneinander
dahockten wie die Zielfiguren einer Schießbude. Noch nie zuvor
in ihrem ganzen Leben.
Vater schloß die Tür des Arbeitszimmers und sah sie
an.
»Nein, schau mich nicht so an, Daddy. Es ist nichts. Tut mir
leid, ich hätte das nicht sagen sollen. Ich hätte einfach
dasitzen und lächeln und so tun sollen, als würde ich
essen, ohne einen Idioten aus mir zu machen. Tut mir leid.«
»Wir hätten heuer nicht wieder alle einladen sollen.
Deine Mutter sagte… ich hätte auf sie hören sollen.
Und ich hätte das über das Leiden nicht sagen sollen. Mein
Fehler, Kleines. Du bist noch nicht bereit dafür.«
»Ich werde nie bereit sein für dein bigottes Verstecken
vor der Realität mit Hilfe der Religion!«
»Vielleicht nicht«, sagte Dan O’Brien ruhig.
»Das habe ich auch nie von dir verlangt.«
»Ich glaube, ich fahre besser nach Hause.«
»Bitte bleib da. Du mußt ja nicht zum Essen kommen,
wenn du nicht willst. Du kannst hierbleiben und lesen. Du kannst auch
meine Druckfahnen weiterkorrigieren.« Er grinste, ein müdes
Grinsen so voll Schmerz, daß Judys Zorn ebenso schnell verflog,
wie er gekommen war. Das machte ihr Angst. In diesen Tagen kamen und
gingen ihre Emotionen so rasch, daß sie sich gar nicht mehr
anfühlten wie die ihren. Wie sie. Sie war jemand anders, nicht
mehr in Kontrolle dessen, was sie fühlte und wie lang sie es
fühlte.
»Nein, ich fahre lieber«, sagte sie. »Wirst du es
Mama erklären?«
»Ja, Liebes, mach ich. Möchtest du nicht vorher noch
irgend etwas essen?«
»Nein, Daddy. Ich kann nicht.«
»Na gut.«
Sie warf sich in seine Arme. »Immerzu schleiche ich mich
heimlich aus diesem Haus. Tut mir leid.«
»Es wird besser werden, Judy. Es wird nicht ewig so weh
tun.«
Aber nicht, weil du oder dein Gott irgend etwas dazu beitragen
könnten, dachte Judy, aber sie sprach es nicht aus. Sie
hatte in diesem Haus bereits genug Unruhe gestiftet.
Es gab andere, bessere Orte, um Unruhe zu stiften. Die es mehr
verdienten.
Ich werde herausfinden, wer ihn umgebracht hat, dachte Judy
und merkte, daß der Gedanke die Macht eines Gebetes
besaß.
Im selben Moment, als Judy zur jährlichen Winter-Party der
McBrides stieß, war ihr klar, weshalb Barbara so um den
heißen Brei herumgeredet hatte, als es um Judys Kommen gegangen
war. Auf der anderen Seite des Wohnzimmers stand, ein Glas
weißen Wein in der Hand und in ein Gespräch mit Mark
Lederer vom Bostoner Institut für biomedizinische Forschungen
vertieft, Caroline Lampert.
Judy hängte ihren Mantel in die Garderobe der McBrides; ihre
Hände zitterten kein bißchen. Sie nickte ein paar Leuten
zu, die sie nicht kannte, und ging direkt in das zum Bersten volle
Eßzimmer, wo das kalte Büffet auf einem Tisch, dem man die
Stühle entzogen hatte, angerichtet war.
»Judy! Ich habe dich nicht kommen sehen! Wie geht’s dir, Liebes?«
»Ganz gut, Barbara. Und dir?«
»Ach, du weißt, wie es zu den Feiertagen ist. Hektisch,
hektisch. Thanksgiving war ein solches Durcheinander, am liebsten
hätte ich alle umgebracht… Oh! Ich meine, ich… Du
siehst wunderbar aus! Und die Haarfarbe paßt dir
Weitere Kostenlose Bücher