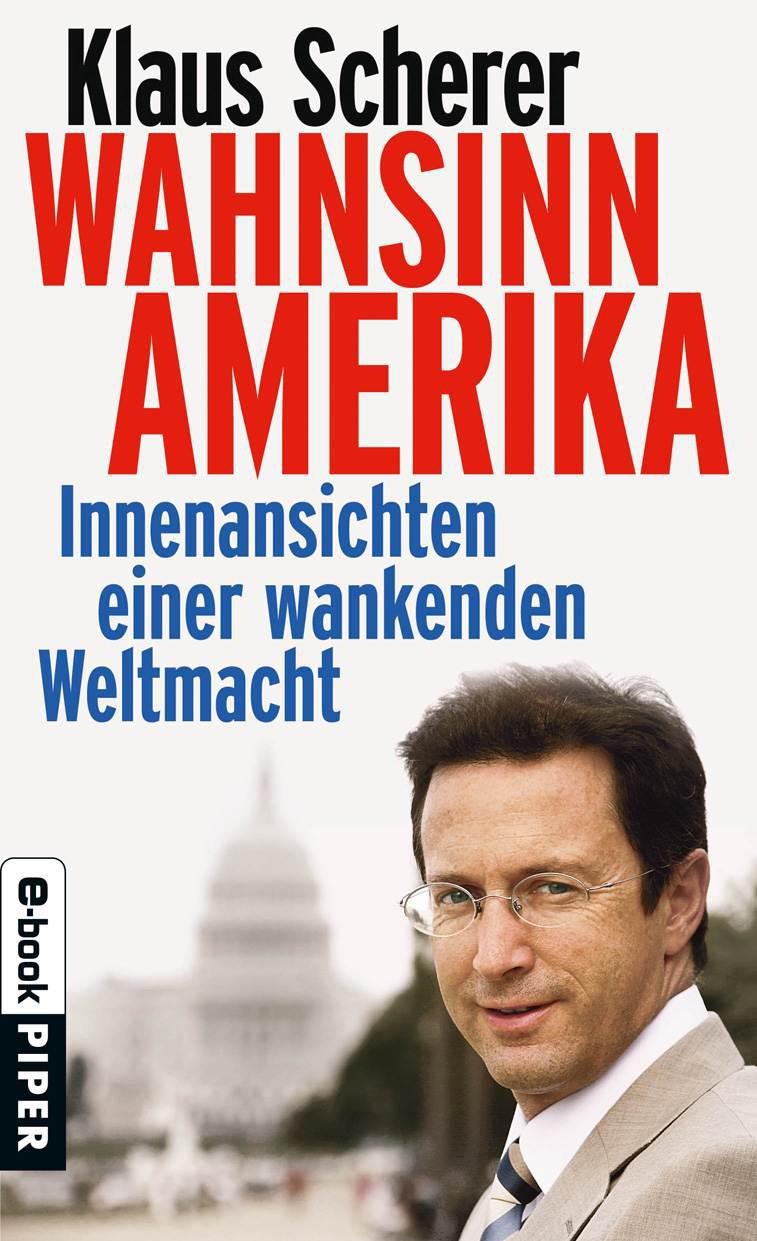![Wahnsinn Amerika: Innenansichten einer Weltmacht (German Edition)]()
Wahnsinn Amerika: Innenansichten einer Weltmacht (German Edition)
Appelle des Präsidenten, sich nun aus seinen Steuerhilfen ihren Millionenbonus sichern, wirkt er zum ersten Mal so, wie viele es nicht für vorstellbar hielten – schwach, hilflos und nur mit leeren Worten hantierend. Wie sollte er die Welt führen, wie er es eben noch versprochen hatte, wenn schon die eigenen verhassten Wall-Street-Banker ihn zum Narren hielten?
Umso härter trifft es danach den Konzernchef von General Motors. Obama zwingt ihn zum Abtreten. Mit den Stimmen der Demokratenmehrheit im Kongress kauft sich die Regierung bei GM und Chrysler ein, um aus ihnen in erstaunlich kurzer Zeit wieder marktfähige Konkurrenten zu machen. Der Ford-Konzern erneuert sich ohne Staatshilfen. Der Preis für Obamas Handlungsspielraum ist dennoch hoch: eine weitere Verschuldungssumme, die sich nun noch zum Riesendefizit der Bush-Jahre aus Kriegskosten und Steuergeschenken hinzufügt, begründbar allenfalls durch weitreichende Reformen, die sich später auszahlen sollen.
»Aber er hat tatsächlich große Pläne«, findet Hess, »nicht nur in der Wirtschafts- und Umweltpolitik, auch bei der Bildung, im Gesundheitswesen, bei der Infrastruktur des Landes.« Möge ja sein, dass ihm nicht alles gelinge, aber er gehe es zweifellos wie geboten an, im großen Stil und in höherem Tempo als die allermeisten seiner Vorgänger. »Als Politiker und Mensch wird die Welt ihn mögen«, prophezeit er, »unabhängig davon, ob sie Amerikas Einfluss als Großmacht mag. Jedenfalls hatten wir im Weißen Haus noch nie solch einen Weltbürger.«
Der Rechtsaußen-Republikaner Steve King aus Iowa hadert derweil weiter mit dem Wahlergebnis. Er glaube nicht, dass seine Partei nun rasch eine neue, aussichtsreiche Führungsfigur finden werde, sagt er. Dafür sei Obama zu populär und die Vorherrschaft der Demokraten im US-Kongress nunmehr zu deutlich. »Andererseits«, freut er sich, »haben wir nun keinen eigenen Präsidenten mehr im Weißen Haus, der zu viel Geld ausgibt und dessen Politik wir mit verteidigen müssen. Das war wirklich eine Bürde.«
Stephen Wayne, Politikprofessor an der Washingtoner Georgetown-Universität, glaubt ein »klares Statement Amerikas« zu erkennen, »dass es die Demokraten an der Macht sehen möchte«. Obama habe Bundesstaaten gewonnen, die seit Jahren republikanische Stammländer gewesen seien, wie Virginia, Florida und North Carolina. Und anders als McCain, dem viele Konservative eher pflichtschuldig die Stimme gaben, habe er seine Wähler begeistert. »Er ist ruhig und gefasst, progressiv, aber auch pragmatisch«, lobt er. »Er wird Politik weder nach rechts noch nach links verlagern. Aber sein Problem wird sein, dass er für Kompromisse die Zustimmung von allen Seiten braucht. Deshalb wird er zunächst auch kleine Schritte als Wandel verkaufen müssen.«
Tatsächlich versucht Obama in jenen Monaten, konservative Parlamentarier von seinen Vorhaben zu überzeugen, indem er sie als volkswirtschaftlich sinnvoll anpreist. Bis zum Sommer will er so vor allem die Gesundheitsreform durchsetzen. Und bis zum Herbst, also vor dem Klimagipfel in Kopenhagen, zudem neue Klimagesetze. »Wenn wir dazu in Amerika überhaupt eine Chance haben«, sagt uns ein regierungsnaher Berater unter der Hand, »dann nicht, weil wir von einer grünen Energiewende oder gar vom Vorbild Europa reden. Es gelingt nur, wenn wir vermitteln, dass die Reformen unserer Wirtschaft nutzen und damit im ureigenen nationalen Interesse liegen.«
Die Sicht der Nachbarn
Als im Kongress Obamas erste Rede zur Lage der Nation ansteht, klopfe ich an die Türen zweier Nachbarn. In deren Gärten waren mir während des Wahlkampfs bunte Schilder aufgefallen – eines für Obama, das andere für McCain. Ich fragte mich damals, ob sie wohl noch miteinander redeten. Nun will ich für die Tagesthemen das Ereignis aus Wohnzimmersicht verfolgen. Beide Familien sind einverstanden – solange sie nicht im selben Raum sein müssen. »Sie bekämen da wohl keine ehrlichen Reaktionen«, geben sie mir zu bedenken, »denn wir würden einander sicher nicht verletzen wollen.«
Ihre gute Nachbarschaft habe sich zuletzt den Grenzen der Belastbarkeit genähert, kokettieren sie. Ich bin einverstanden. Wir werfen eine Münze und starten bei den Obama-Freunden.
»Der Präsident darf nicht straucheln«, sagt die Gattin, als dessen Rede beginnt, und wirkt angespannt. Derweil spricht Obama über die Bankenkrise. Wenn Finanzhäuser Boni auszahlen könnten, dann sei ihnen auch eine
Weitere Kostenlose Bücher