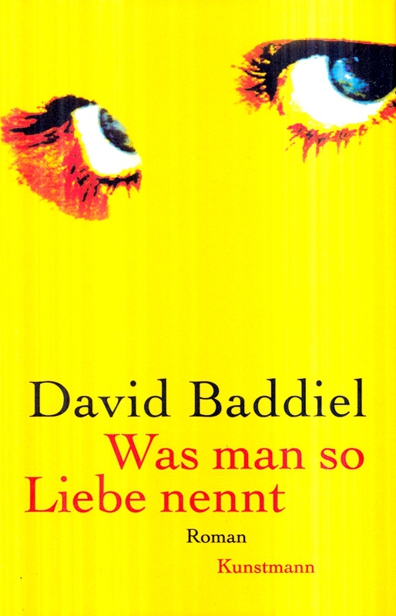![Was man so Liebe nennt]()
Was man so Liebe nennt
seiner Tasche.
»Ähhmm...«, sagte Joe zögernd. Wie hieß der Kerl verdammt noch mal bloß? »Entschuldigen Sie...?«
Der Pfleger blickte hoch, höfliches Interesse im Gesicht. Joe gab sich einen Ruck und stellte ihm die Frage.
»Ist... ist meine Frau vor zwei Tagen hier gewesen?«
Der Mann runzelte die Stirn und kratzte sich ziemlich theatralisch am Kopf. »Ich glaube nicht.«
»Bitte, es ist wichtig. Dienstag nachmittag oder am frühen Abend?«
Der Ausdruck der Pflegers wurde ein wenig kühler. »Nun, Sir. Wie ich schon sagte, ich glaube nicht. Mein Gedächtnis ist völlig in Ordnung.«
»Ich wollte ja nicht sagen...«
»Außerdem — wie Sie ja wissen, müssen sich alle Besucher bei mir im Büro anmelden. Wir können natürlich gern hingehen und im Besucherbuch nachsehen, aber ich versichere Ihnen, daß Sie daraus ersehen werden, daß Mrs. Serenas letzter Besuch...«, er verdrehte die Augen, »letzte Woche war. Freitag, wird dort mit Sicherheit stehen.«
Joes Hoffnungen sanken. Wie schrecklich, daß er solch eine wichtige Information im mechanischen, gefühllosen Beamtenton erhielt.
»Na gut«, sagte er. »Vielen Dank.«
Joe wandte sich zur Tür. Wie dumm von mir, Sylvias Singen eine so große Bedeutung beizumessen, dachte er. Sie hatte Carole Kings Lied vielleicht gestern im Radio des Tagesraums gehört. Das war gut möglich. Und in seinem Inneren war er ein wenig beschämt über seine Erregung — sich so blind auf die Hoffnung zu stürzen, daß Emma ihn immer noch liebte, und ganz zu vergessen, daß sich sein ganzes Hoffnungsgebäude darauf stützte, daß ihr Tod Selbstmord war. Der eine Gedanke mochte tröstend und beruhigend sein, aber der andere — der öffnete einem ganz neuen Feld von Selbstvorwürfen und Schuldphantasien Tür und Tor.
»Sie hat Ihnen wohl erzählt, daß sie hier war, was?«
Joe fuhr herum. Der Pfleger war in den Küchenbereich gegangen; als er mit einem Glas Wasser in der Hand wieder zurückkam, lauerte ein anzügliches Grinsen in seinem runden roten Gesicht. Während Joe den Schritten des Manns mit den Augen folgte, erwog er verschiedene Möglichkeiten: mit gedehnter Stimme »Wie bitte?« zu sagen oder »Was wollen Sie damit andeuten?« oder einfach hinzugehen und ihm in seine runde rote Fresse zu hauen. Statt dessen sagte er ausdruckslos: »Sie ist tot.«
Alle Röte verschwand aus dem Gesicht des Manns. Immerhin, dachte Joe finster, hatte die Nachricht in diesem Raum hier endlich die Einschlagkraft, die ihr gebührte und von der bisher nichts zu spüren gewesen war.
»O mein Gott... Mr. Serena... das tut mir leid... ich hatte ja keine Ahnung...«
Joe ignorierte ihn und ging zu Sylvia hin, die, wie er merkte, abgeschaltet hatte. Er beugte sich hinab und nahm ihre Hand und dachte an Emmas Hand, wie sie die ihrer Mutter streichelte.
»Auf Wiedersehen, Sylvia... Ich komme bald wieder«, sagte er.
Sie guckte ihn an und nickte, so als verstünde sie. Dafür wenigstens war Joe dankbar. Er beugte sich noch weiter hinab und küßte sie auf ihre pergamentene Wange. Und dann, als er sich wieder aufrichtete und in ihr hoffnungsvoll zu ihm aufgewandtes Gesicht sah, fiel sein Blick auf den herzzerreißenden Notizblock auf dem Telefontischchen neben ihr, und wie Untertitel gingen Joe Vics Worte durch den Kopf: Wenigstens wird sie nicht enden wie ihre Mum... den Rest ihres Lebens neben einen Telefon absitzen, das nie klingelt.
Ein Telefon, das niemals klingelt.
VIC
V ic trug Kontaktlinsen, seit er dreizehn war. Davor war er ein Jahr lang mit Brille herumgelaufen, wogegen sich aber sein ganzes Teenagerego sträubte. Er wußte noch, wie er das erste Mal die Linsen angelegt hatte (damals gab es noch nicht die Ausfertigungen, die so hauchdünn wie eine Zellschicht sind); seine Augen hatten heftig gegen diesen Fremdkörper rebelliert, der ihnen aufgezwungen wurde, und sein Lid hatte sich immer unwillkürlich geschlossen, sowie ihm die Fingerspitze mit der Linse näher kam, und dann das unerträgliche seifige Brennen und Tränen seiner Augen, wenn das Plastik schließlich auf der Pupille klebte. Er erinnerte sich auch noch, wie er, als er das erste Mal mit den Linsen ausging, dauernd das Gefühl hatte, er hätte seine Brille vergessen. Er konnte sich noch so oft sagen, daß er sie nicht mehr brauchte, trotzdem wurde er das Gefühl nicht los, daß ihm etwas fehlte; es nagte beständig an seinem Hirn, setzte sein Alarmsystem in Gang und sorgte für das ständige Rumoren in seinem
Weitere Kostenlose Bücher