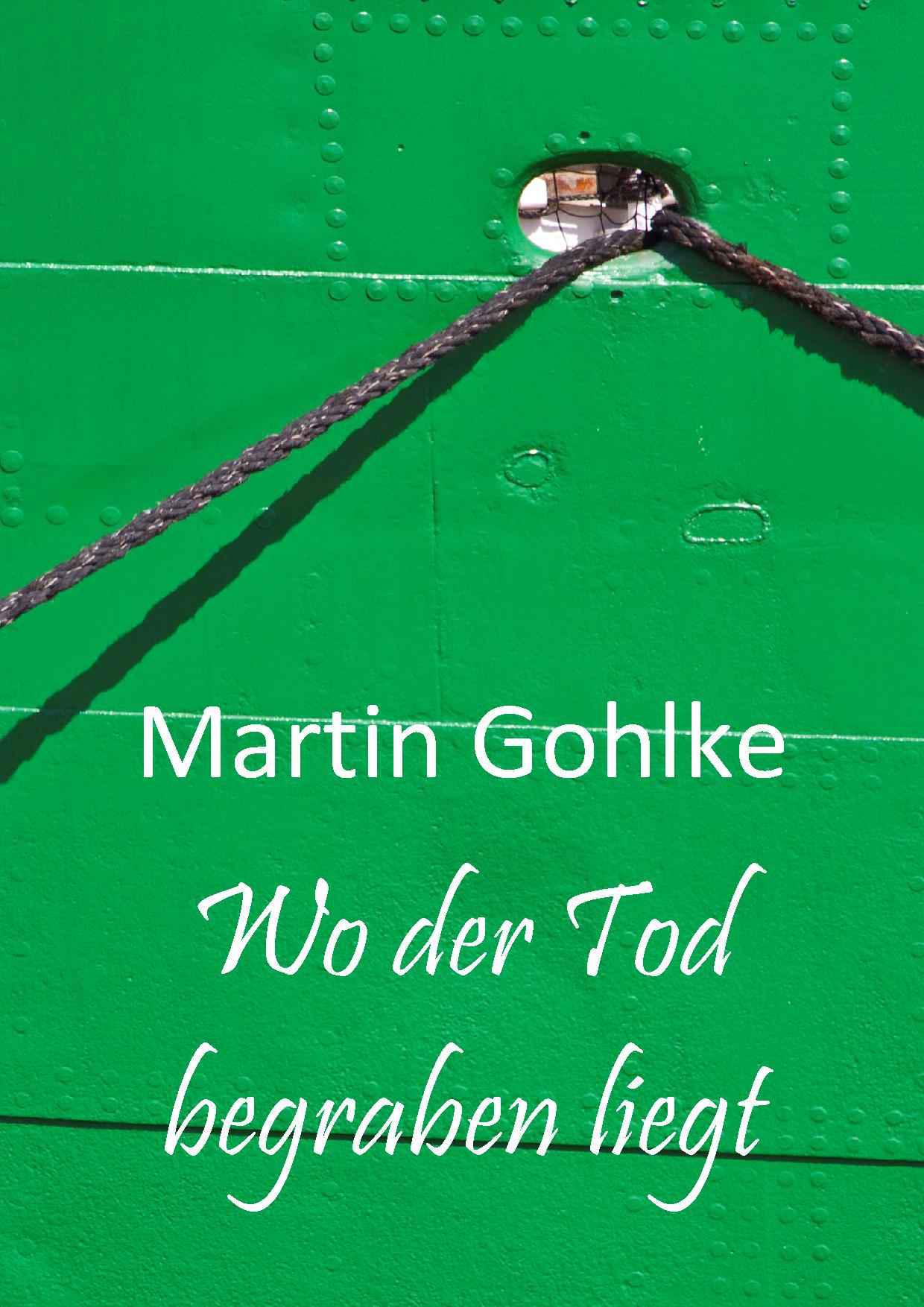![Wo der Tod begraben liegt (German Edition)]()
Wo der Tod begraben liegt (German Edition)
konnte man zu Rockmusik tanzen.
Genau gegenüber der Wohnung hatte vor kurzem ein eigenartiges Lichtspielhaus, das sich später einmal Kommunalkino nennen sollte, den Betrieb aufgenommen. Es zeigte in diesem Frühsommer des Jahres 1968 fast ausschließlich Filme aus Frankreich, denn alle Welt interessierte sich im Moment für die politischen Ereignisse in diesem Land, die später unter der Überschrift „Pariser Mai“ berühmt werden sollten und von denen ein Frankfurter katholischer Kleriker gerade behauptete, dass sie „vom Teufel gemacht“ seien, eine Deutung, die im hiesigen Stadtviertel kaum einer teilte: „Eher ist Jesus dort die Hauptfigur“, hatte Manfred in der Nachbarschaft vernommen.
Die Straße war, obwohl es schon auf den Samstagnachmittag zuging, voll von Menschen. Viele wohnten in anderen Stadtteilen und wollten nach ihrem Einkauf in der Innenstadt noch das bunte Viertel genießen, dabei etwas essen oder trinken. Beim Blick auf das Treiben der Menschenmassen überlegte sich Manfred, ob auch er eine kleine Mahlzeit außerhalb seiner Wohnstätte einnehmen sollte. Aber mehr noch als sein weniges Geld, das ihm zur Verfügung stand, hielt ihn sein Grübeln davon ab. Er befürchtete, mitten im Essen den Appetit zu verlieren, eine Aussicht, die er sich finanziell nicht leisten konnte. Lieber wollte er heute Abend ein Bier mehr trinken und eine Frikadelle dazu essen und sich jetzt, sollte sein Magen ihn dazu treiben, ein Brot schmieren. Denn das war schließlich zum Verzehr eingekauft und nicht zum Vergammeln. Zudem hielt er ein solch eher trostloses Mittagessen gut zu seiner Stimmung passend. Was ist eigentlich die Steigerung von Trübsal blasen, fragte er sich.
Hier in der Wohnung immer hin und her zu laufen ist vielleicht gar nicht so schlecht, um irgendwann wieder besser drauf zu kommen, sann Manfred weiter. Besser als draußen ziellos umherzuwandern; augenblicklich hielt er es für möglich, dass bald Millionen von Menschen als Freizeitbeschäftigung rumlaufen, weniger in ihren Wohnungen, sondern in den Wäldern und Parks, vielleicht sogar durch die Straßen. Weil sie alle nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Chaos, schloss Manfred nicht aus.
Manfred blieb in seinen Gedanken, änderte aber das Thema. Nun ist meine – wieso eigentlich meine? – Ilona krank, sie liegt mit einer Grippe im Bett, mitten im späten Frühsommer. Die Krankheit ist es nicht, die Manfred übergroße Sorgen machte. Fieber und Gliederschmerzen überlebt man ja, dachte er, jedenfalls in unserem Kulturkreis. Nein, ich sehe und höre Ilona nicht mehr, das ist mein Problem. Sechs Wochen hatten wir fast täglich Kontakt, ob nun telefonisch oder von Angesicht zu Angesicht – erst wegen des Referats und dann für die Anfertigung der schriftlichen Hausarbeit. Und als das vorbei war, war Schluss. Wir hatten ja keinen Grund mehr für den Kontakt, also ließen wir es. Nicht, dass wir nicht gern weiterhin voneinander gehört hätten, das ging ihr, das kann eigentlich nicht anders sein, genauso wie mir. Trotz Grippe hätte man ja miteinander telefonieren können. Aber wir lassen es einfach, so als sei es die normalste Sache der Welt. So ist das halt mit uns, so ähnlich ist das ja auch früher schon oft gewesen, es ist nur ein weiteres Kapitel aus unserer komischen Art miteinander umzugehen. Oder eben nicht umzugehen, wie man es auch drehen will. Mal können wir uns unsere Sympathien gar nicht deutlich genug zeigen und mal machen wir auf Fremde. So wie jetzt, als hatte es sich bei unserem sechswöchigen Dauerkontakt lediglich um eine Art besonders langgezogenes geschäftliches Mittagessen gehandelt. Natürlich hätte ich mich gleich nach zwei Tagen wieder bei ihr melden können, fragen wie es geht, aber warum soll ausgerechnet ich das machen und nicht sie?
Oder ist alles ganz anders, fragte sich Manfred. Wenigstens für die Krankmeldung hätte sie sich ja bei mir melden können, das hätte nun wirklich nahegelegen. Hätte ich dann an die Uni weiterleiten können. Stattdessen erfahre ich das über den Professor. „Frau Ilona Jakobs kommt übernächste Woche zum Besprechen der Hausarbeit in meine Sprechstunde und bittet Sie, dann auch zu erscheinen.“ Was sollte ich von der Auskunft halten? War die Nachricht ein gutes Zeichen, ein Zeichen dafür, dass sie sich eigentlich gemeldet hätte, wenn sie nicht gewusst hätte, dass sie mich in zweieinhalb Wochen in der Sprechstunde sowieso wieder sieht? Oder war das genau umgekehrt gemeint,
Weitere Kostenlose Bücher