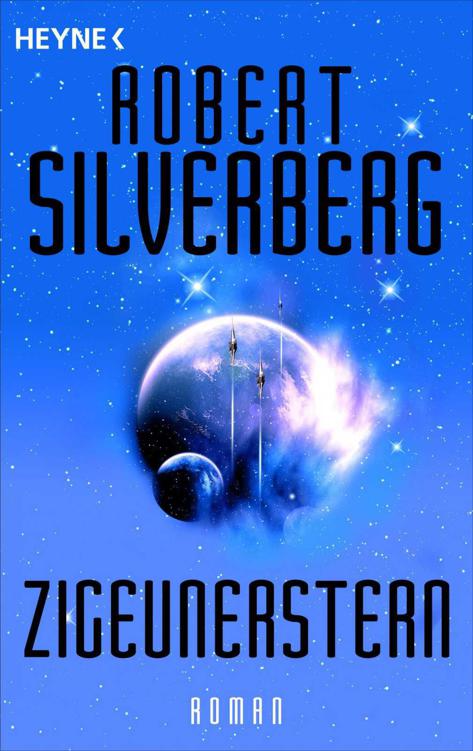![Zigeunerstern: Roman (German Edition)]()
Zigeunerstern: Roman (German Edition)
immer – sowohl an Bord des Luftwagens wie auch an jedem Ort, an dem wir übernachteten – von befremdender Kargheit: schlichte weiße Wandbehänge, eine dünne Matratze auf dem Boden und ein Krug Wasser daneben. Mir kam es so vor, als lasse er den Pomp der Empfänge als etwas Notwendiges über sich ergehen, als von amtswegen zu erduldende Pflicht, sei aber herzlich froh, dann all dies abschütteln zu dürfen, wenn er allein sein konnte. (Übrigens, Freunde, wenn ihr die Wahrheit über einen Mann erkennen wollt, dann seht euch an, wie er schläft!)
Nabomba Zom ist von Natur aus eine zu Großartigkeit und Pracht neigende Welt. Ich habe niemals etwas Schöneres gesehen – außer natürlich Xamur, der Welt ohnegleichen, die von nichts übertroffen werden kann. Aber Nabomba Zom kommt dem ziemlich nahe. Da ist diese verblüffende scharlachrote See, die bei Sonnenaufgang wie hämmergepunztes Metall spiegelt, wenn die ersten blauen morgendlichen Strahlen auf sie treffen. Dann die fahlgrünen Berge, die samtweich das Rückgrat des großen Zentralkontinents bilden. Die Seenkette, als ›die hundert Augen‹ bekannt, onyxschwarz und onyxscharf schimmernd, östlich davon. Die Schlangenschlucht, dieser fünftausend Kilometer lange Grabenbruch, der sich zwischen golden schimmernden Wänden dahinwindet, die bis in unermessliche Tiefen zu dem Feuerfluss hinabreichen. Oder der Brunnen des Weines, wo unsichtbare Geschöpfe in einem unterirdischen Kelterbecken eine natürliche Gärung erzeugen, und von wo aus in stündlichem Abstand ein Geysir ihr köstliches Erzeugnis in die Luft hinaufsprüht. Die Feuermauer – die Tanzenden Berge – das Edelsteingespinst – die Große Sichel …
Und alle die fruchtbaren Felder, auf denen aller Art Früchte üppig wachsen. Es gibt keine Gegend im Universum, die reichere Erträge brächte. Sogar der Kot der Riesenschnecken (und das hatte ich ja schließlich bereits vorher selbst herausgefunden) war von nicht geringem volkswirtschaftlichen Wert.
Natürlich fuhr ich nicht die ganze Zeit mit Loiza la Vakako in seinem Luftwagen auf Inspektionstouren über diesen Wunderplaneten. Es galt nun, meine restliche Erziehung zu bewerkstelligen. Lesen und Schreiben beherrschte ich – mehr oder weniger –, aber damit erschöpfte sich auch bereits mein gesamtes Schulwissen, das ich hierher mitgebracht hatte. Loiza la Vakako hatte seine Gründe – sehr wohlfundierte, wie ich später erfahren sollte – dafür, mich häufig an seiner Seite auftreten zu lassen, wenn er seinen Amtspflichten nachkam, doch er holte auch verschiedene Tutoren in den Palast, die mich unterrichten mussten, und was mehr ist, er bestand darauf, dass ich sie ernst nähme. Ich tat es; mein Lebensappetit ist nämlich sehr groß, und eine meiner unstillbaren Lüste gilt dem Wissen. Immerhin ist ja am Leben noch etwas mehr dran als Fressen und Rülpsen und dergleichen. Deshalb widmete ich mich voller Eifer und Hingabe meinen Studien.
Und dann war da auch noch Malilini.
Ich wusste nicht so recht, was ich von ihr zu halten hatte. Sie schwebte durch den Palast wie eine Elfe, eine kleine Göttin, ein Geisterspuk – sie war alles, nur keine gewöhnliche Sterbliche. Ich glaube, während der ersten drei Jahre meines Aufenthaltes dort hat sie wohl kaum sechs Worte zu mir gesagt – oder ich zu ihr. Aber ich ertappte sie oft dabei, wie sie mich beobachtete (sie hatte genau die gleichen wachen, gescheiten Augen wie ihr Vater), heimlich, aus der Ferne, oder indem sie mich frank und offen anstarrte, wenn wir uns im selben Raum befanden.
Sie jagte mir Angst ein. Durch ihre Schönheit, durch ihre Grazie, durch ihre Fremdartigkeit. Ich wusste, dass sie als Wandergeist zu mir auf Megalo Kastro gekommen war – auch damals hatte sie mich so angestarrt, ohne jemals ein Wort zu sprechen –, und dass sie mich beschützt hatte, als ich in der warmen Puddingsee gestrandet war, in die mich der Gildenscherge geschleudert hatte. Aber warum? Warum hatte sie damals, bei unserer ersten realen Begegnung, als man mich von meinem schönen Job als Schneckenscheißesammler weggeholt und vor ihren Vater gebracht hatte – warum hatte sie damals gesagt: »Yakoub! Endlich …?«
Zu fragen wagte ich nicht. Im Grunde war Schüchternheit nie ein hervorstechendes Merkmal meines Wesen, aber damals fürchtete ich mich vor Erklärungen, ich wollte sie nicht provozieren, aus Angst, dadurch irgendeinen zarten Zauber zu zerstören, der uns aneinander binden mochte. Zur rechten
Weitere Kostenlose Bücher