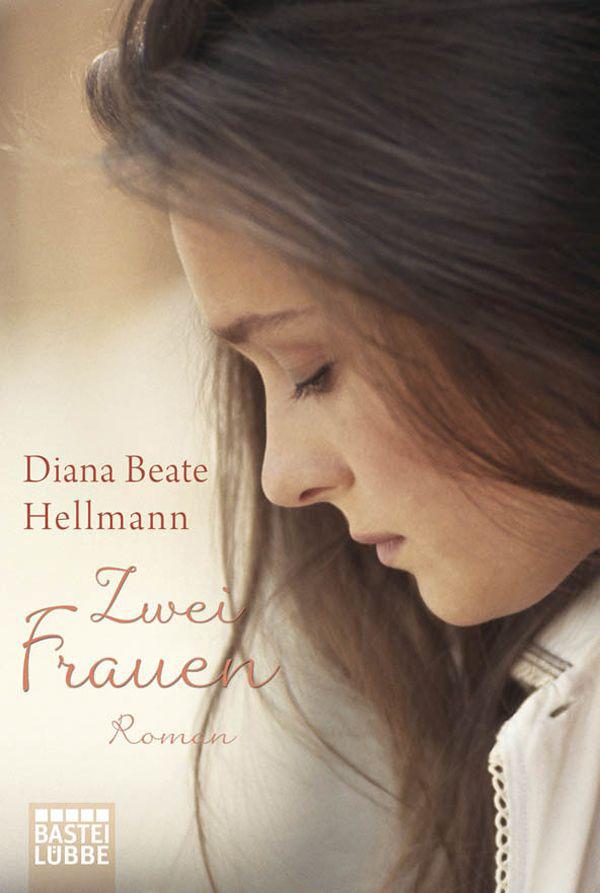![Zwei Frauen: Roman (German Edition)]()
Zwei Frauen: Roman (German Edition)
desinteressiert gab.
»Keine Böcke!«, kläffte sie nur.
»Aber du musst es dir vorstellen!«, beschwor ich sie. »Es war einfach … ein Mann wie ein Baum … und diese wirren Haare … und dieser Blick …«
Da ich hörbar ins Schwärmen geraten war, blitzte Claudia mich vernichtend an.
»Doof wie en Baum is er«, knurrte sie dabei, »und Stehhaare hat er, weil er sons nix hochkriecht, und ihm sein Blick … dat kommt vom Saufen …!«
Ich ahnte, dass Claudia eine ganze Menge von diesem Karl-Heinz Becker wusste, der mich so faszinierte. Also versuchte ich, sie auszufragen, was mir jedoch nicht gelang. »Wat weiß ich!«, war das Einzige, was ich ihr entlocken konnte, und nachdem ich das etwa zwanzigmal in Folge gehört hatte, platzte mir der Kragen.
»Aber du weißt doch sonst immer alles!«, schimpfte ich.
Claudia erwiderte nichts, sie sah mich nur an. Etwas Ängstliches lag in diesem Blick, etwas Zweifelndes, aber statt mir darüber Gedanken zu machen, war ich nur wütend über ihre fehlende Hilfsbereitschaft. Aus lauter Wut beschloss ich, im Alleingang »wat rauszukriegen«.
Da ich bei diesem Unternehmen nicht gerade diplomatisch vorging, war mir zunächst nur mäßiger Erfolg beschieden. Ich fragte Schwester Helma nach den Familienverhältnissen der Beckers und – erhielt keiner Auskunft. Daraufhin fragte ich Doktor Behringer, der mir auch nicht half, und so fragte ich Schwester Gertrud, zu der ich eigentlich nur ein sehr distanziertes Verhältnis hatte. Sie mochte mich nicht, weil ich so ehrgeizig und deshalb für ihre Begriffe psychopathisch war, und ich mochte sie nicht, weil ich erfahren hatte, dass sie vor ihren letzten Ferien aus »sozialen« Gründen eine Abtreibung hatte vornehmen lassen, von der sie sich anschließend auf Gran Canaria hatte erholen müssen. Auf Grund dieser gegenseitigen Abneigung erstaunte es mich jetzt umso mehr, dass ausgerechnet sie sich in puncto Familie Becker so redselig zeigte.
»Oh, das ist eine schlimme Geschichte«, erklärte sie mir, und dann erfuhr ich, dass Andrea Becker wie ich an Lymphosarkomen litt, neunundzwanzig Jahre alt war und zwei Kinder hatte.
»Und der Mann?«, erkundigte ich mich hastig.
»Der Mann?« Gertrud sah mich skeptisch an. Für einen Moment rang sie mit sich, ob sie es nicht besser für sich behalten sollte, doch dann siegte der weibliche Mitteilungsdrang.
»Der Mann ist Maurer von Beruf«, sagte sie seufzend. »Früher hat er fest in einer Kolonne gearbeitet, aber seit seine Frau stationär behandelt wird, lebt er vom Stempelgeld. Weil er nämlich nicht will, dass die Kinder in ein Heim kommen. Er ist selbst im Waisenhaus groß geworden.«
Jedes einzelne Wort, das Gertrud sagte, speicherte ich, um mir anschließend noch stundenlang den Kopf darüber zu zerbrechen. In der Welt, in der ich groß geworden war, gab es weder Maurer namens Karl-Heinz Becker noch Fürsorge-Fälle oder Sozialhilfe-Empfänger. Dennoch war ich mir nach wie vor sicher, schon mal mit den Beckers zu tun gehabt zu haben, und deshalb beschloss ich, Andrea Becker meine Aufwartung zu machen.
Ich war ziemlich aufgeregt, als ich anklopfte. Im Grunde meines Herzens war ich mir völlig sicher, gleich einer alten Bekannten gegenüberzustehen und damit das Rätsel Becker gelöst zu haben.
»Herein!«
Zögernd trat ich ein und schloss die Tür hinter mir.
»Ja! – Bitte?«
Die Frau, die das sagte, saß in ihrem Bett und sah mich an. Sie war nicht mehr jung, sah zumindest älter aus, als es normalerweise mit neunundzwanzig Jahren der Fall ist. Ihr Haar war kurz, blond und von einer jener Dauerwellen verunziert, die Vorstadtfriseure im Sonderangebot anpreisen: Löckchen für Löckchen stach steif in die Luft. Ihre Augen waren blau und ausdruckslos, und um das zu verbergen, hatte sie die Lider mit blauer Farbe bepinselt, die Wimpern aber nicht getuscht. Ihr Mund hatte etwas Verkniffenes. Sie biss die Zähne so fest aufeinander, dass die Lippen völlig verschwanden, und noch während ich all das registrierte, wurde mir klar, dass sich meine geheime Hoffnung nicht erfüllt hatte. Ich kannte diese Frau nicht, ich hatte sie noch nie zuvor in meinem Leben gesehen.
Andrea Becker bemerkte nicht, wie genau ich sie in Augenschein nahm. Sie war nur erstaunt über meinen Besuch, aber da wir beide an der gleichen Krankheit litten, benutzte ich diese Tatsache sofort als Vorwand. Das nahm sie mir ab, war aber nicht gewillt, über ihren Krebs zu sprechen. »Das bringt ja nichts«,
Weitere Kostenlose Bücher