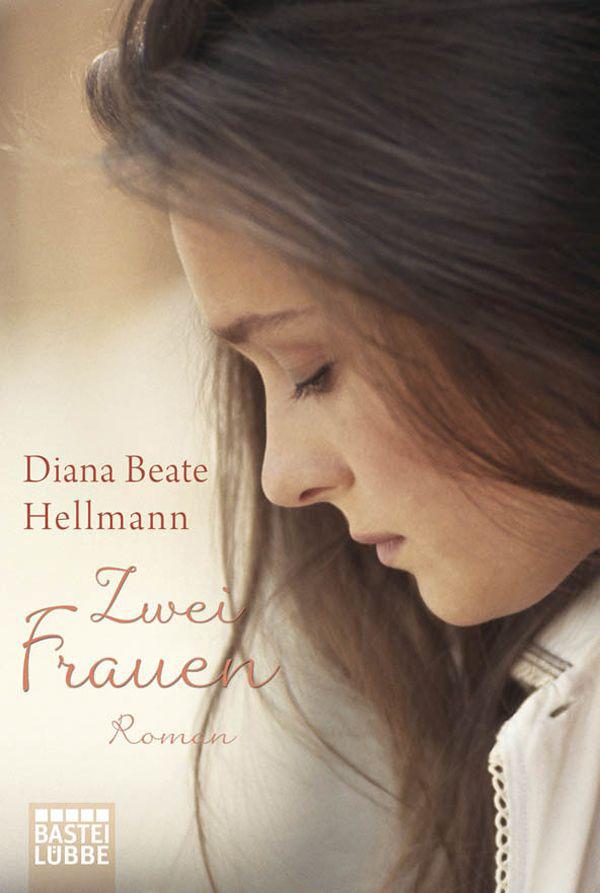![Zwei Frauen: Roman (German Edition)]()
Zwei Frauen: Roman (German Edition)
ertragen. Aber Gott hörte mich nicht. Er schien weiter von mir entfernt als jemals zuvor, und sobald ich ihn anrief, war mir, als spräche ich gegen undurchdringliche Wände. Das trieb mich fast in den Wahnsinn.
Eines Abends lag ich zusammengekauert in meinem Bett und sprach schluchzend den 23. Psalm.
»Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.«
Plötzlich strich Claudia mir über die Stirn.
»Sei stille«, flüsterte sie, »dat hilft nix. Hier is kein Hirte, Schätzken, hier mangelt et an alle Ecken. Keine Wiese, Wasser gibt et nur dat ohne Kohlensäure und den Wech, den zeigen dir de andern. Frach ma Mennert und Behringer, die sagen, wo et langgeht. Dich tröstet hier auch kein Schwein, Eva, und einreiben tut dich auch keiner. Und hier in dat Haus bleibse auch nich. Wenn de nämlich nich aufpasst, liechse zack-zack inne Kiste. Du musst dir selber helfen, an dich musse glauben, an dich.«
Erschüttert sah ich sie an. Die Sicherheit, mit der sie den Bibeltext verunglimpft hatte, zeigte mir, wie gut sie ihn kannte. Claudia Jacoby war dieser 23. Psalm vertrauter als mir, sie war keine religiöse Analphabetin. Sie spürte, dass ich das in jenem Augenblick durchschaute, und seufzte tief. »Frach mich jetz bloß nix!«, meinte sie. »Aber glaub et mir, Eva, auf dich musse jetz vertrauen, sons bisse verratzt!«
»Verratzt« fühlte ich mich schon länger. Dass ich es jedoch selbst in der Hand hatte, diesem unwürdigen Zustand ein Ende zu bereiten, wollte mir nicht in den Sinn.
Ich hatte meines Erachtens überhaupt nichts in der Hand, ich brauchte ja nur in den Spiegel zu schauen, um das zu erkennen. Mein ausgemergeltes Körperchen wog nur noch vierundsiebzig Pfund und ließ Knochen sichtbar werden, von deren Existenz gesunde Menschen bestenfalls im Biologieunterricht erfuhren. Man sah die genaue Form meines Schulterblatts, die Rippenknorpel am Ansatz meines Brustbeins, den Verlauf von Elle und Speiche an meinen Unterarmen. Am schlimmsten hatte es jedoch mein Gesicht getroffen: Die Haut war bleich und aufgedunsen, und die Poren waren riesengroß. Die Augen traten weit aus den Höhlen und waren umrandet von tiefen, schwarzen Ringen. Die Lippen hatten eine fast violette Färbung und waren aufgeplatzt und verborkt. So ähnlich hatte Claudia ausgesehen, als ich sie kennen lernte. Nun war ich es, die so aussah. Das war ich, das war von mir geblieben. Ich war nur noch das Spiegelbild meiner Krankheit, ein Teil jenes Schattens, den der Krebs aus mir gemacht hatte. Und auf diesen Schatten meines Ichs konnte ich einfach nicht vertrauen. Ich war zu einem Nichts geworden.
Bald bildete ich mir ein, das überall bestätigt zu sehen. Wenn ich über die Gänge schlich und vorübergehenden Leuten in die Augen sah, blickten sie durch mich hindurch. Ich lächelte sie an, aber sie erwiderten mein Lächeln nicht. Ich grüßte, aber sie antworteten nicht. Es stimmte also, ich war nur noch ein Schatten.
Dieser Schatten saß manchmal am Spätnachmittag auf der Bettkante und beobachtete den Totentanz der Sonnenstrahlen. Ich sah, wie sie schwanden, und ich stellte mir vor, wie sie in Auflösung begriffen seien. Auch ich verging, vielleicht saß ich ja schon gar nicht mehr auf der Bettkante, vielleicht war ich ja schon fort, versunken.
Professor Mennert spürte, wie schlecht es mir ging. Da sich außerdem meine Laborwerte verschlechtert hatten, brach er die Chemotherapie vorläufig ab. Schon wenige Tage später ließ meine Übelkeit nach, das Herz hörte auf zu schmerzen, meine Leber schwoll wieder ab, Blasenkatheter, Darmrohr und Magensonde wurden entfernt.
Meine Eltern glaubten, das wäre mein Verdienst, und belohnten mich mit einer Stereo-Anlage. Ich selbst glaubte, dass die Besserung meines Zustands ein Geschenk des Himmels wäre, und deshalb hätte ich vor lauter Glück am liebsten die ganze Welt umarmt. Ich stellte fest, dass ich plötzlich wieder beten konnte; Gott hatte mich also doch noch nicht verlassen. Es
Weitere Kostenlose Bücher