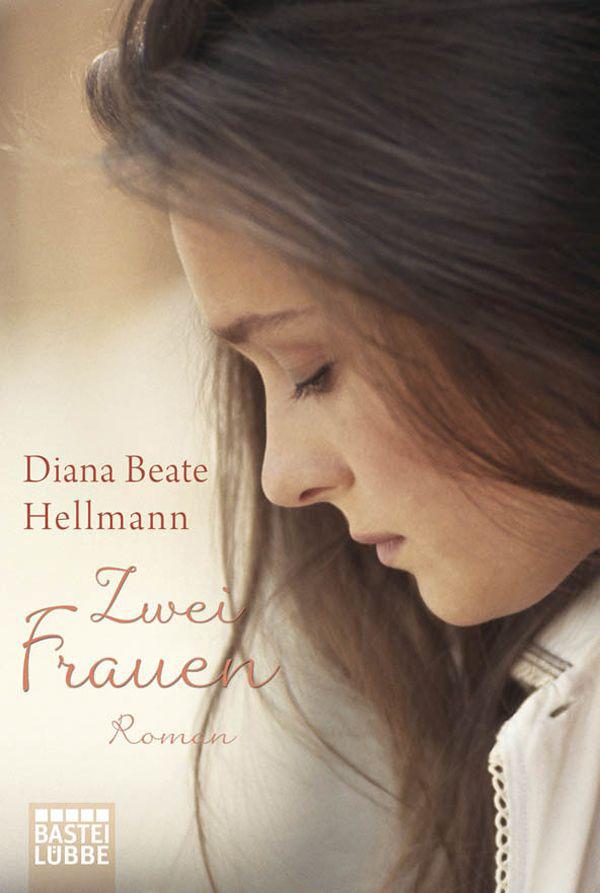![Zwei Frauen: Roman (German Edition)]()
Zwei Frauen: Roman (German Edition)
Unverschämtheiten. Sie verschwand während der Visite auf unbestimmte Zeit und äußerte zwischen den Mahlzeiten Wünsche, als wäre sie Gast eines Sechs-Sterne-Hotels.
Das Kuriose daran war, dass sich plötzlich niemand mehr darüber aufregte, selbst Schwester Helma lächelte immer nur milde. Eines Morgens lag Claudia mit der brennenden Zigarette im Mund da, während Professor Mennert ihren künstlichen Darmausgang untersuchte. Die Asche schnippte sie lässig in seine Kitteltasche, und als er es bemerkte, lachte er und meinte: »Liebstes Fräulein Jacoby!« Da reichte es mir. Dieses Geschöpf war zwar gekettet an Klinik und Bett, aber inmitten all dieser Ketten war sie frei wie kaum ein anderes Wesen in diesem Universum, und das musste einen Grund haben.
Claudia grinste nur, als ich sie nach dem Sinn dieser Privilegien fragte.
»Kennse Cäsar und Kleopatra?«, fragte sie mich scheinheilig.
»Natürlich!«
»Nee, die kennse bestimmt nich. Dat sind nämlich unsern Professor Mennert seine Lieblingsmäuse, drüben int Labor. – Kennse denn wenichstens Tristan und Isolde?«
»Ja, aber –«
»Auch nich wahr, die kennse auch nich, weil dat nämlich unsern Professor seine Lieblingskarnickel sind. Hasse immer noch kein Schimmer?«
Ich musste zugeben, dass ich immer noch nicht begriff. Erst als Claudia mir im Detail berichtete, sah ich Licht: Dieses Mädchen arbeitete für die Forschung. Ohne mit der Wimper zu zucken, ließ sie sich mit Präparaten behandeln, die zuvor ausschließlich an Versuchstieren erprobt worden waren.
»Das ist aber doch wahnsinnig gefährlich«, rief ich.
»Dat ganze Leben is gefährlich, Evken, is ne tödliche Angelegenheit.«
»Ja, aber man muss es doch nicht herausfordern.«
Claudia lächelte nur. »Weiße«, sagte sie leise, »ich nehm mich und mein Kadaver nich so ernst wie ihr. Ich glaub nich, datte Welt untergeht, bloß weil ich int Gras beiß, und mir macht et auch nix aus, wenn ich von die eine oder andre Pille kotzen muss. Zuerst kriegen et de Ratten und de Mäuse, dann de Kaninchen, dann de Affen, und dann schluckt Jacoby. Macht mir nix. Dafür tu ich in die wenige Zeit, die ich hab, wat mir Spaß macht. Und wenn et mir nu grade ma Spaß macht, unsern Behringer innen Arsch zu treten, hat er ebent Pech gehabt. Ich darf dat.«
Ich fand das ungeheuerlich, vor allem aber fand ich es bewunderungswürdig.
»Da bisse nich die Einzigste«, sagte Claudia. »Bevor die hier damit einverstanden warn, ham se mich tausend Papierkes unterschreiben lassen, und auf dat Geistige ham se mich auch untersucht. Die wollten sichergehn, dat ich dat freiwillig tu.«
»Tust du es denn freiwillig?«, fragte ich.
»Logo!«
»Warum? Warum tust du es?«
Wieder lächelte Claudia, und was sie sagte, sagte sie ohne jede Sentimentalität:
»Weil ich sons eh zu nix mehr taug. Wenn die mit meine Hilfe ne Pille gegen Leukämie finden, dann hat et sich gelohnt, Eva, verstehse? Dann hat dat wat gebracht, dat ich mir in all die Jahre den Arsch hier wund gelegen hab. Wenn nur ein einzigen Menschen nach mir die Seuche überlebt, weil ich mich gequält hab, … dann war et dat wert!«
Ich schluckte, und ich schämte mich. Vor allem aber traf ich noch in der gleichen Nacht eine endgültige Entscheidung hinsichtlich meiner zweiten Chemotherapie. Claudia hatte mich zutiefst gerührt. Sie hatte mir aber auch mit dem, was sie sagte, und mit dem, was sie mir vorlebte, einen ganz neuen Weg gezeigt. Was immer das Leben mir fortan auch antat, es durfte nicht umsonst geschehen. Bei allem musste ich an die Menschen denken, die ich liebte, an die Menschen, die nach mir leben und nach mir erkranken würden.
Am Abend vor Beginn der neuen Chemotherapie saß ich dann in meinem Bett und betete inbrünstig. Ich wusste, dass Gott allein mir die Kraft geben konnte, die Hölle einer neuerlichen Behandlung zu überstehen. Ich betete und betete; wenn ich zwischendurch vor Erschöpfung einschlief und dann wieder aufwachte, war ich jedes Mal schweißgebadet, und meine Hände zitterten. Ich hatte Angst, Gott würde mich nicht erhören …
Am nächsten Morgen kam Schwester Helma, beladen mit einem Tablett, auf dem Unmengen kleiner Töpfchen standen.
»So!«, flötete sie morgenfroh. »Jetzt werde ich unserer Eva erst einmal die neuen Medikamente zuteilen.«
Auf meinen Nachttisch stellte sie einen Kasten, der über zahlreiche Einteilungen verfügte, die mit den Hinweisen »morgens«, »mittags«, »abends«, »nachts« überschrieben
Weitere Kostenlose Bücher