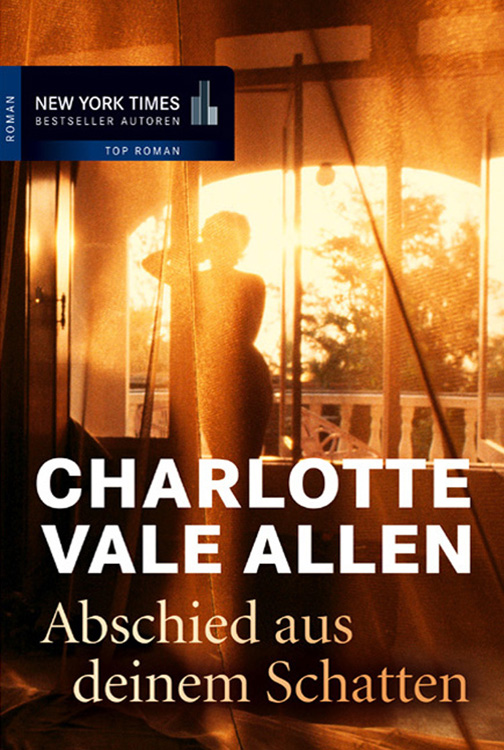![Abschied aus deinem Schatten]()
Abschied aus deinem Schatten
Zeit ihr Gesicht beobachtete, als könne er daran die Wirkung seiner Stöße ablesen. Und zum ersten Mal wirkte Claudias Gesicht so nackt wie ihr Körper. Die Augen fest geschlossen, die Zähne in der Unterlippe verbissen, krampfte sie beide Fäuste ins Laken und warf den Kopf hin und her, bis sie plötzlich erstarrte und die Sehnen an ihrem Hals deutlich hervortraten, bis sie den Mund aufriss zu einem stummen Schrei und ihr Körper in Spasmen erschauerte.
„Das war nicht gespielt!” flüsterte Rowena und blinzelte ungläubig mit den Augen. Die Krämpfe, die ihre Schwester durchzuckten, die tiefe Röte, die Hals und Gesicht überzogen – all das konnte niemand allein durch reine Willensanstrengung herbeiführen.
Reid hielt inne und blieb in der Hocke sitzen, während Claudia sich noch zuckend über seinem Schoß spreizte. Nachdem sie zur Ruhe gekommen war, löste er sich von ihr und schob sie, durchaus nicht unsanft, von sich herunter. Danach las er seine Kleidung vom Boden auf, zog sich an, schlüpfte in seine Schuhe und trat vom Bett weg, während Claudia sich aufsetzte und etwas zu ihm sagte. Er beachtete sie jedoch nicht und ging weiter. Plötzlich gab es nur noch Geflimmer – nicht jenes verräterische Lächeln in die Kamera, sondern bloß ein abruptes Ende.
Rowena stoppte das Band, schaltete alle Geräte aus und starrte den dunklen Bildschirm an. Sie fühlte sich leer und ausgebrannt; ihre Brust war wie ein morsches Gehäuse aus dürren Zweigen mit einem gebrochenen, mutlos gewordenen Herz darin. Dieselbe Einsamkeit, die sie schon nach Carys Tod verspürt hatte, überkam sie nun auch, allerdings noch schlimmer. Damals lag zumindest eine Zukunft vor ihr, auf die sie gespannt sein durfte, jener Teil des Lebens, in dem sie wie in jedem Märchen, das sie gelesen hatte, glücklich weiterleben konnte, denn das versprachen Märchen ja stets: und wenn sie nicht gestorben sind … Jetzt aber stand sie mit leeren Händen da.
Sie hatte Menschen vertraut, nicht einem, sondern zweien – und es war ein Fehler gewesen. „Wer nicht hören will, muss fühlen”, schalt sie sich. „Aus Schaden wird man klug.” Zuerst Penny, und nun Reid. Penny war Vergangenheit. Aber wie sie mit Reid umgehen sollte, das musste gut überlegt sein. Eins nach dem anderen! Schwankend stolperte sie die Treppe hinauf, holte die Kamera aus ihrem Versteck und trug sie in den Keller hinunter. Dann nahm sie einen Hammer, kniete sich auf den kalten Estrich der Waschküche und zerschlug das Gerät. Schwer atmend schob sie die Teile zu einem Häuflein zusammen und drosch weiter so lange auf diesen ein, bis sie den Arm kaum noch bewegen konnte. Sie ließ alles auf dem Estrich liegen, schleppte sich hinauf in die Küche und trank noch einen Schluck Wodka. Nachdem sie sich das Gesicht an ihrem schweißfeuchten Ärmel abgewischt hatte, torkelte sie endlich ins Bett.
18. KAPITEL
S chrille, mechanische Piepstöne fuhren ihr wie rasche Nadelstiche durch den Schädel. Stöhnend brachte sie den Wecker zum Schweigen und setzte sich auf, eine Bewegung, die in ihrem Kopf scheinbar eine ganze Steinlawine und in den Schläfen ein pulsierendes Pochen auslöste. Ihr Mund war ausgetrocknet und pelzig, sodass sie kaum mehr schlucken konnte. Mehrere Minuten musste sie, unfähig zu jeder Bewegung, in gekrümmter Haltung auf der Bettkante verharren. Ihr war, als kündige sich eine Grippe an: Schmerzen in allen Gliedern, Kopfweh, Fieber. Egal, welche Krankheit sie befallen hatte – tödlich schien sie auf jeden Fall zu sein.
Dann endlich fiel ihr nach und nach alles wieder ein – das Videoband, die vielen Zigaretten, der Wodka, und sie begriff, dass sie einen schrecklichen Kater hatte, eine entsetzliche Erfahrung für sie. Ihr Magen rumorte, die Hände zitterten; ihr Kopf fühlte sich an, als sei er plötzlich aus Glas und dreimal so groß wie vorher und drohe wegen eines ungeheuren Innendrucks zu zerspringen.
Vor Übelkeit krümmte sie sich zusammen und hatte eine Weile das Gefühl, als befinde sie sich in einem grenzenlos weiten, menschenleeren Raum. Am liebsten wäre sie tot gewesen – keine Spielchen, keine Konflikte, nicht der geringste Kummer, nur ein weißes, wunderbares Nichts. Warum aber, so fragte sie sich plötzlich, sollte sie sich aufgeben, nur weil sie schlecht behandelt worden war? Sollten nicht im Gegenteil diejenigen den Tod herbeisehnen, die ihr das Böse angetan hatten? Jene Menschen, die ihr einiges bedeuteten und die doch schlimme Sachen
Weitere Kostenlose Bücher