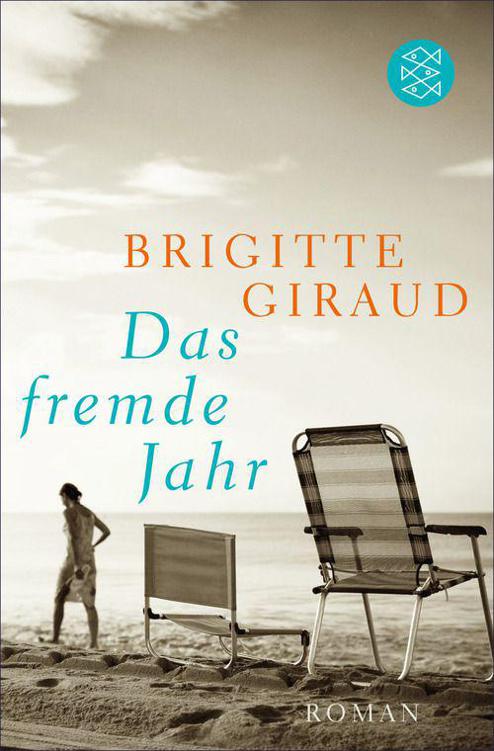![Das fremde Jahr (German Edition)]()
Das fremde Jahr (German Edition)
abhängig machen? Als wir das Geschäft wieder verlassen, ist es schon dunkel und ich kann meine Sonnenbrille nicht aufsetzen, was sehr enttäuschend ist. Wir gehen die Fußgängerzone hinauf, wo die Straße sehr rutschig ist, und stehen plötzlich vor dem Büro, in dem Herr und Frau Bergen arbeiten. Wie neulich schon setze ich mich auf einen Stuhl, betrachte erneut den Kalender und freue mich, dass meine erste Woche vorbei ist. Ich weiß nicht, was Frau Bergen macht, ich höre sie im Büro nebenan Schubladen aufziehen und Schranktüren öffnen. Ich denke, dass sie ein Dossier mit nach Hause nehmen will. Als wir vor der Gittertür der Bücherei stehen, haben sie gerade zugemacht. Frau Bergen wirkt zuerst überrascht, dann sagt sie, es tue ihr leid. Ich höre mich antworten: »Das ist nicht schlimm« – ein Satz, den ich während meines Aufenthalts Dutzende von Malen sagen werde. Es ist nicht schlimm, nein, nichts ist schlimm, was kann hier, an der Grenze Deutschlands, schon Schlimmes passieren, wo ich doch niemanden kenne, niemand für mich unentbehrlich ist, es keinen Menschen gibt, den ich vermissen würde, wenn er plötzlich nicht mehr da wäre. Wir bleiben einen Moment vor der Gittertür stehen, und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, ich muss Frau Bergen nur folgen, hinter ihr hergehen, als wäre ich ein streunendes Hündchen, ein Mädchen ohne Schicksal. Ich kann nur mit Frau Bergen zu ihrem Auto zurückkehren, weil sie mir zu essen gibt, ein Dach über dem Kopf, ein schmales Bett in einem kleinen Zimmer, in dem es nach Benzin stinkt. Nein, es ist nicht schlimm, von den Benzindämpfen wird mir zwar kotzübel, aber ich kann mich ausstrecken, die Musikkassetten hören, die ich mitgebracht habe, und an Simon schreiben. Ich kann Simon erzählen, was ich von meinem neuen Leben in Deutschland erwarte, ich kann ihm sagen, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, dass es gut war, dass ich von zu Hause weggegangen bin und von Eltern, die verrückt zu werden drohten – auch wenn ich mich schuldig fühle, weil ich ihn im Stich und mit einer Familie alleingelassen habe, die schwer an ihren Erinnerungen trägt.
Ich schneide die Kartoffeln in dünne Scheiben, die ich in die Auflaufform lege, gieße Crème fraîche und Milch darüber, dann kommt wieder abwechselnd eine Schicht Kartoffelscheiben, wieder Crème fraîche und Milch. Thomas reibt den Käse und bleibt bei mir in der Küche. Er schaltet den Backofen ein, stellt den Thermostat auf sehr heiß ein, aktiviert die Zeitschaltuhr und holt die Auflaufform aus dem Backofen, als alles fertig ist. Er schaut mich mit strahlenden Augen an, als ich sage: »Wir haben schön gearbeitet.« Wir klatschen je eine Hand aneinander, und ich weiß nicht, was dann passiert, für den Bruchteil einer Sekunde, vielleicht weil mir die Hitze des Backofens guttut: jedenfalls ist es wie eine Welle der Zärtlichkeit, wahrscheinlich die erste, die ich seit meiner Ankunft verspüre, ein sehr leichtes, kaum wahrnehmbares Gefühl, das bewirkt, dass ich mich wieder spüre, hier, in einer deutschen Küche stehend, inmitten von Geschirrtüchern, Kartoffelschalen und dem Spülbecken voller Küchenutensilien, einer Küche mit einem Kühlschrank, der größer ist als ich, einem Schiebefenster, das zur Garage führt, einer Reservegasflasche, die vorübergehend in einer Ecke steht. Dort verspüre ich zum ersten Mal seit sehr langer Zeit eine gemeinsame Begeisterung, den Beginn einer Komplizenschaft. Dabei reden wir nur wenig, Thomas und ich. Reden ist nicht sein Ding. Es sind Blicke und kleine Gesten, die er taktvoll einsetzt, seine Art, mir den Kopf zuzudrehen, wenn er sich morgens von mir verabschiedet, sein etwas schiefes Lächeln, wenn er nach Hause kommt und sich den Helm abnimmt. Und seine Art, wie er die langen Haare schüttelt und sich mit einem kurzen Blick vergewissert, ob ich ihn anschaue. Ich lache in der Küche mit Thomas und fasse endlich etwas Vertrauen, statt weiterhin auf der Hut zu sein, aber vermutlich sehne ich mich so sehr danach, wieder ein normales Leben zu führen, dass ich nicht misstrauisch bin. Ich weiß aber noch nicht, wohin das führen wird.
Meine Mutter ist am Telefon ein Ausbund an Zurückhaltung, Anstand und Selbstbeherrschung. Ihre Stimme wühlt mich auf, aber ich will keine Schwäche zeigen, und deshalb bemühe ich mich um einen neuen Tonfall, locker und unbeschwert, der sie davon überzeugen soll, dass es mir gutgeht und ich eine sehr positive
Weitere Kostenlose Bücher