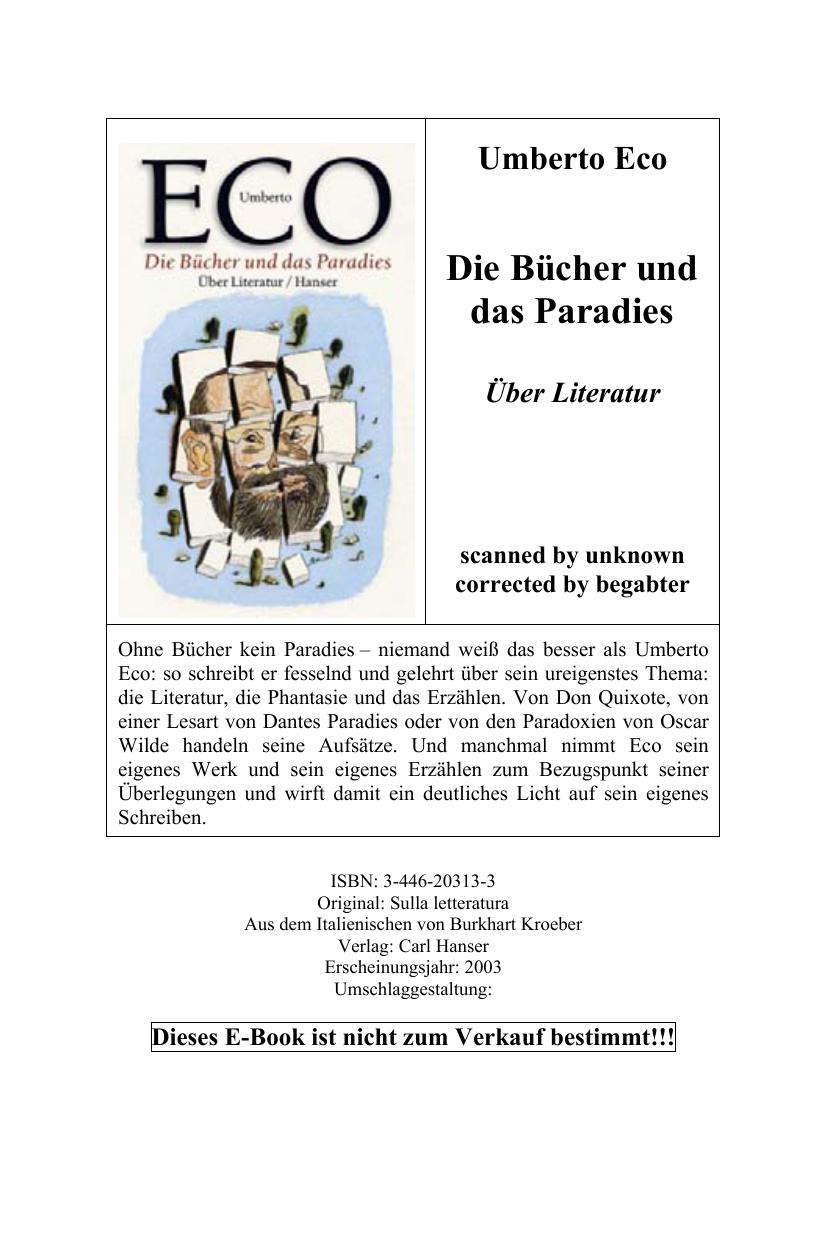![Die Bücher und das Paradies]()
Die Bücher und das Paradies
Wie man sieht, läßt
dieses »natürlich« schon ahnen, was intertextuelle Ironie
ist.
Kommen wir nun zu den Charakteristika des
postmodernen Erzählens zurück. Was die Selbst-
bezüglichkeit angeht, so kann der Leser die betreffenden
Reflexionen unmöglich übersehen. Er kann sich durch sie
gestört fühlen, er kann sie ignorieren (überspringen), aber
er kann nicht übersehen, daß sie da sind. Dasselbe gilt für
die Verwendung von expliziten Zitaten, wie im Falle des
Troubadours bei Dante. Dem Leser kann sehr gut ver-
borgen bleiben, daß Arnaut hier in seiner eigenen
Troubadoursprache spricht, aber er bemerkt auf jeden Fall,
daß er in einer Sprache spricht, die nicht die der
Commedia ist, daß also Dante hier etwas Fremdartiges zitiert, sei es auch nur die Art, wie die Provenzalen
sprechen.
Um zur Doppelkodierung zu kommen, halten wir erst
einmal fest, daß es mehrere Arten von Lesern geben kann
(woran man sieht, wie viele Facetten dieser Begriff hat),
nämlich a) einen Leser, der die Vermengung von »hohen«
und »niederen« Stilmitteln und entsprechenden Inhalten
nicht akzeptiert und daher die Lektüre verweigert, aber
dies eben, weil er die Vermengung erkennt, b) einen
Leser, der sich damit sehr wohl fühlt, weil ihm dieser
Wechsel von Schwierigkeit und Entgegenkommen,
Herausforderung und Einladung gefällt, und schließlich
262
c) einen Leser, der das ganze Werk als liebenswürdige
Einladung auffaßt und gar nicht merkt, in welchem
Umfang es elitäre Stileme zitiert (der also das Werk
genießt, aber die Bezugnahmen nicht wahrnimmt).
Nur dieser dritte Fall führt uns in die Strategie der
intertextuellen Ironie ein. Wer angesichts jenes
»natürlich« das Augenzwinkern versteht, stellt ein
privilegiertes Verhältnis zum Text (oder zur Erzähler-
stimme) her. Wer es nicht versteht, liest trotzdem weiter –
und hat dann zwei Möglichkeiten: Entweder ihm geht von
selber auf, daß es sich bei jener Handschrift um eine
literarische Fiktion handelt (deren Raffinesse er dann zum
ersten Mal schätzen lernt, wodurch seine Kompetenz als
Leser »wächst«), oder er schreibt mir einen Brief und fragt
mich – wie es viele getan haben –, ob diese faszinierende
Handschrift tatsächlich existiert. Einen Unterschied sollte
man jedoch beachten: In Fällen von beispielsweise
architektonischer Doppelkodierung kann dem Betrachter
sehr wohl verborgen bleiben, daß eine Säulenreihe mit
Tympanon die griechische Tradition zitiert, und trotzdem
wird er die Harmonie und geordnete Vielfalt dieses
Bauwerks genießen. Dagegen weiß der Leser, der den
Sinn meines einleitenden »natürlich« nicht erfaßt, beim
Weiterlesen bloß, daß er eine alte Handschrift liest,
während ihm die Bezugnahme und ihre liebevolle Ironie
entgeht.
Ein Werk kann von Zitaten aus anderen Texten nur so
wimmeln und trotzdem kein Beispiel für intertextuelle
Ironie sein. Um nur eines zu nennen, Eliots Waste Land
erfordert viele Seiten Anmerkungen, um alle Bezug-
nahmen auf die Welt nicht nur der Literatur, sondern auch
der Geschichte und der Ethnologie zu erklären, aber Eliot
macht seine Anmerkungen gerade, weil er sich keinen
263
naiven Leser vorstellen kann, der nichts von all dem
versteht und trotzdem imstande ist, seinen Text
hinreichend zu genießen. Ich würde sagen, die Anmer-
kungen sind ein integraler Bestandteil des poetischen
Textes. Gewiß könnten »ungebildete« Leser sich damit
begnügen, den Text wegen seines Rhythmus und Klanges
zu schätzen, wegen jenes Quantums an Phantasmatischem
und Phantasieanregendem, das auf der Inhaltsebene
erkennbar wird, und dabei irgendwie ahnen, daß es noch
mehr zu erfassen gäbe, also mit anderen Worten das Werk
genießen wie jemand, der durch eine halb geöffnete Tür
horcht und nur Andeutungen einer verheißungsvollen
Enthüllung sieht. Aber das wären für Eliot (glaube ich)
keine vollwertigen Leser, es wären nicht die Modell-
Leser, die er anstrebte und sich heranbilden wollte.
Fälle von intertextueller Ironie gibt es dagegen diverse,
und eben deshalb charakterisieren sie Formen von
Literatur, die bei allem Bildungsanspruch auch breiten
Erfolg haben können: Der Text kann naiv gelesen werden,
ohne daß der Leser die intertextuellen Bezüge erfaßt, oder
er kann in vollem Bewußtsein dieser Bezüge gelesen
werden, zumindest in der Überzeugung, daß es sich lohnt,
nach ihnen zu suchen. Um einen Grenzfall zu nehmen:
Stellen
Weitere Kostenlose Bücher