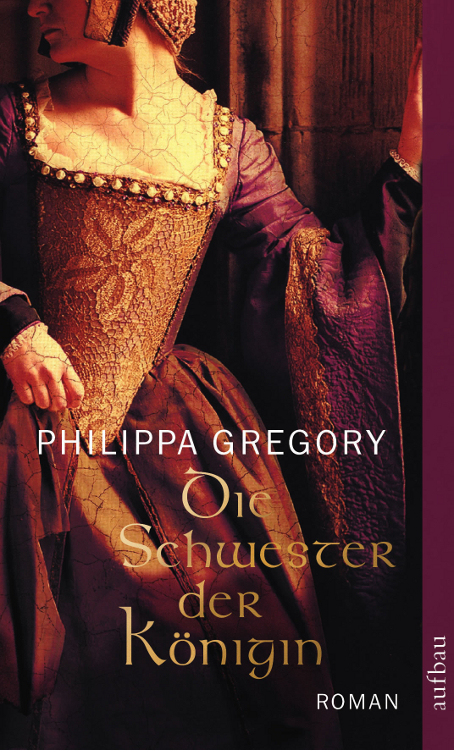![Die Schwester der Königin - Gregory, P: Schwester der Königin]()
Die Schwester der Königin - Gregory, P: Schwester der Königin
der
Mary Boleyn.
Nur die Königin gab ein Unwohlsein vor und blieb der Schiffstaufe fern. Aber der spanische Botschafter schaute zu, wie das Schiff ins Wasser glitt, und falls er Bedenken wegen des Namens hegte, so behielt er sie diskret für sich.
Mein Vater schäumte insgeheim vor Wut – auf sich, auf mich, auf den König. Es hatte sich nämlich herausgestellt, daß die große Ehre, die man mir und meiner Familie erwies, durchaus ihren Preis hatte. König Henry handelte in derlei Angelegenheiten sehr geschickt. Als mein Onkel und mein Vater sich für das Kompliment bedankten, daß ihr Name verwendet wurde, sprach er ihnen seinerseits Dank aus für ihren Beitrag zur Ausstattung eines solchen Schiffs, den sie sicherlich gern leisten würden, da es doch den Namen Boleyn über alle Meere tragen würde. »Und so ist der Einsatz wieder erhöht worden«, meinte George fröhlich, als wir zuschauten, wie das Schiff über die Rollen ins salzige Wasser der Themse glitt.
»Wie kann er denn noch höher werden?« fragte ich lächelnd. »Mein Leben ist der Einsatz.«
Die Werftarbeiter, die schon vom Freibier betrunken waren, schwenkten ihre Mützen und jubelten. Anne lächelte und winkte zurück. George grinste mich an. »Nun kostet es Vater schon Geld, dir die Gunst des Königs zu erhalten. Jetzt stehen nicht mehr nur dein Herz und dein Glück auf dem Spiel, kleine Schwester, sondern auch noch das Vermögen der Familie. Wir dachten, wir hätten es mit einem verliebten Narren zu tun, doch es stellt sich heraus, daß er uns wie Weihnachtsgänse ausnimmt. Der Einsatz hat sich erhöht. Vater und Onkel wollen sicherlich, wenn mich nicht alles täuscht, eine Rendite für diese Investition sehen.«
Ich blickte mich nach Anne um. Sie stand ein wenig abseits vom Gefolge, und wie immer war Henry Percy neben ihr. Sie beobachteten das Schiff, das Barkassen auf den Fluß geschleppt hatten, die nun wendeten und es mühsam gegen die Strömung zurück an den Pier zogen, wo man es festmachte, um es im Wasser schwimmend zu Ende auszurüsten. Annes Gesicht leuchtete, sie genoß das Flirten.
|125| Sie lächelte mich an. »Ah, die Königin des heutigen Tages!« neckte sie.
Ich zog eine kleine Grimasse. »Mach dich nicht auch noch über mich lustig, Anne. Ich habe schon von George genug Spott zu hören bekommen!«
Henry Percy trat vor, ergriff meine Hand und küßte sie, Während ich auf seinen blonden Hinterkopf blickte, wurde mir klar, wie hoch mein Stern gestiegen war. Vor mir verneigte sich Henry Percy, der Sohn und Erbe des Herzogs von Northumberland. Kein anderer Mann im Königreich hatte eine bessere Zukunft vor sich oder ein größeres Vermögen. Der Sohn des reichsten Mannes in ganz England, vom König abgesehen, küßte mir die Hand.
»Sie soll Euch nicht necken«, versprach er mir, während er sich lächelnd wieder aufrichtete. »Denn ich werde Euch zum Abendessen führen. Man sagt mir, die Köche aus Greenwich seien schon im Morgengrauen hier gewesen, um alles vorzubereiten. Der König geht. Sollen wir ihm folgen?«
Ich zögerte, aber die Königin, die immer eine Atmosphäre der Förmlichkeit verbreitete, war ja in Greenwich zurückgeblieben, lag mit Schmerzen im Bauch und Furcht im Herzen in einem verdunkelten Raum. Hier am Dock war niemand außer den nutzlosen, untätigen Männern und Frauen des Hofstaats. Niemand scherte sich hier um die Etikette. »Natürlich«, antwortete ich. »Warum nicht?«
Lord Percy bot Anne seinen anderen Arm. »Darf ich zwei Schwestern mein eigen nennen?«
»Ich glaube, Ihr werdet feststellen, daß die Bibel derlei nicht gestattet«, provozierte ihn Anne. »Sie befiehlt, daß ein Mann sich zwischen Schwestern entscheiden und dann seiner Wahl stets treu bleiben muß. Alles andere wäre eine Todsünde.«
Lord Henry Percy lachte. »Ich bin sicher, ich könnte einen Ablaß erwerben«, meinte er. »Der Papst würde mir sicher einen Dispens geben. Wie könnte man einen Mann zwingen, sich zwischen zwei solchen Schwestern zu entscheiden?«
|126| Wir brachen erst in der Dämmerung nach Hause auf. Die ersten Sterne zeigten sich schon am blaßgrauen Frühlingshimmel. Ich ritt neben dem König, Hand in Hand mit ihm, und wir lenkten unsere Pferde im Schritt den Treidelpfad entlang. Als wir den Torbogen zum Palast passiert hatten, hielten wir auf das vordere Tor des Schlosses zu. Der König zügelte sein Pferd und saß ab. Während er mich aus dem Sattel hob, flüsterte er mir ins Ohr: »Ich wünschte, Ihr
Weitere Kostenlose Bücher