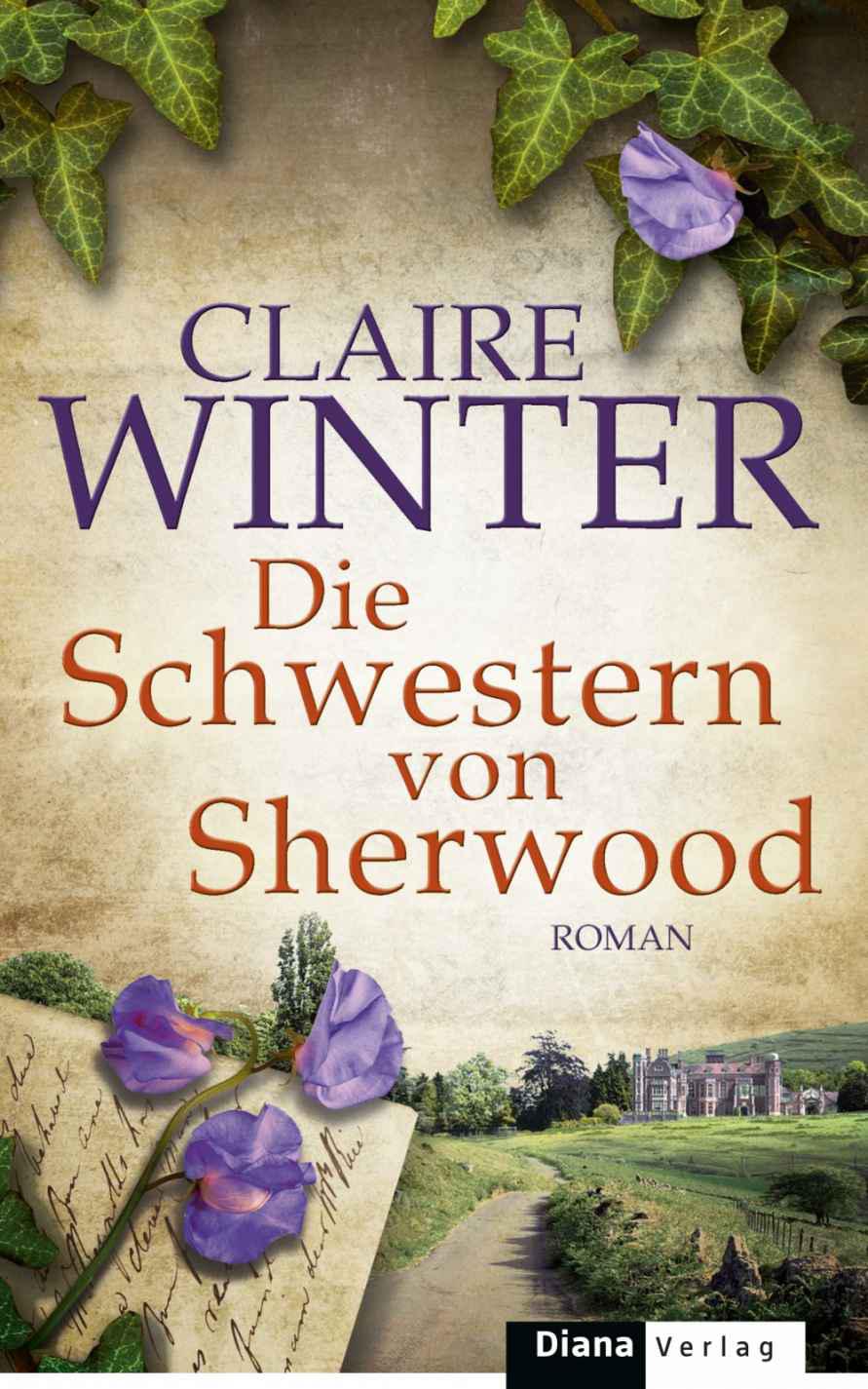![Die Schwestern von Sherwood: Roman]()
Die Schwestern von Sherwood: Roman
ist unser Stempel mit dem alten Schriftzug, wie er zu Zeiten meines Vaters benutzt wurde. Die Figur wurde ganz sicher bei uns gekauft.«
»Meinen Sie, es könnte noch irgendeine Möglichkeit geben herauszubekommen, wer dieses Spiel damals bei Ihnen erworben hat? Es hätte für mich sehr viel Bedeutung.«
Der Antiquitätenhändler fuhr sich mit der Hand übers Kinn. »Nun, im Grunde ja. Mein Vater hat genau wie ich stets über alles Buch geführt. Und eine solche Besonderheit hätte er auf jeden Fall vermerkt. Man müsste nur die Jahre etwas eingrenzen können.«
»Meine Großmutter ist 1897 nach Deutschland gegangen. Ich nehme an, es ist davor gewesen …«
Er nickte. »Ich werde gern einen Blick in die Bücher werfen, Miss. Es ist immer wieder spannend zu sehen, welche Reisen solche Objekte über die Jahrzehnte gemacht haben. Schauen Sie Mitte nächster Woche einfach noch mal vorbei!«
»Danke. Das ist außerordentlich freundlich von Ihnen«, sagte Melinda erfreut, die insgeheim befürchtet hatte, er könnte ihre Bitte ablehnen.
Er lächelte. »Gern.« Sein Gesicht nahm einen gedankenverlorenen Ausdruck an. »Ich entsinne mich übrigens noch, dass mein Vater erzählte, das Schachspiel sei sehr alt gewesen und stamme aus Persien. Es war das Geschenk eines Prinzen an eine Frau, die er sehr geliebt hat.«
Melinda hörte gespannt zu. Ein Mann, der eine Frau geliebt hatte … Sie musste unwillkürlich an die Liebesbriefe denken, die in dem Paket gewesen waren – und für einen Moment konnte sie sich nicht des Eindrucks erwehren, ein Luftzug der Vergangenheit würde durch das kleine Geschäft wehen.
EDWARD
53
London, Sommer 1895
E r starrte in das Ladenfenster, in dem zwischen chinesischen Porzellanvasen und einer französischen Pendeluhr auf rotem Samt einige Schachfiguren ausgestellt waren. Sie waren aus Marmor und so ungewöhnlich filigran gearbeitet, dass er unvermittelt stehen geblieben war. Er hätte nicht einmal sagen können, in welcher Straße er sich befand. Ziellos war er in der letzten Stunde durch London gelaufen, ohne dass er den Fassaden und Gebäuden um sich herum sonderliche Beachtung geschenkt hatte. Erst jetzt merkte er, dass ihn sein Weg in die Portobello Road mit ihren vielen Läden und Antiquitätengeschäften geführt hatte.
Nur einen Augenblick für sich allein, das war alles, was er gewollt hatte. Er hatte das Haus verlassen und sie alle zurückgelassen, die Familie, den Anwalt – und auch den Notar, der heute in der Bibliothek ihres Londoner Hauses das Testament verlesen hatte. Er hatte ihnen sein Beileid bekundet und ihm im selben Atemzug zu dem Titel beglückwünscht, der mit dem Tod seines Vaters nun der seine war. »Ein großer Name«, hatte der Notar gesagt, und dabei hatte sein Gesicht keinen Zweifel gelassen, dass er es unter diesen Umständen vor allem für eine Bürde hielt, ihn zu tragen.
Es war eine gespenstische Situation gewesen. Seine Mutter hatte kerzengerade und mit versteinerter Miene auf einem Stuhl gesessen, seine Schwestern hatten schluchzend geweint. Nicht nur aus Trauer, nahm er an. Die Lage war schlimmer, als sie alle gedacht hatten.
Er selbst hatte wie immer die Fassung bewahrt und sich bemüht, die Souveränität und Haltung zu beweisen, die von einem Mann in seiner Situation erwartet wurde – bereit, die Verantwortung zu übernehmen, die man ihm übertrug. Unabhängig davon, wie schwer sie auch war.
Erst jetzt, da er allein durch die Straßen lief, erlaubte er sich, seinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf zu lassen. Der Tag, den er so gefürchtet hatte, war gekommen. Seine Verzweiflung und der Schmerz waren einem Gefühl der Leere gewichen.
»Glaube mir, kein Mann will so gehen, wie ich gehen muss. Ich weiß, wie groß die Last ist, die du zu tragen hast …«, hatte sein Vater gesagt. Er war nicht leicht gestorben. Über Tage und unter großen Qualen hatte sich das letzte bisschen Leben geweigert, seinen kranken Körper zu verlassen. Niemand sollte so sterben müssen, dachte er jetzt. Er entsann sich, dass ein Geistlicher ihm einmal gesagt hatte, man könne nur in Frieden sterben, wenn man im Moment des Todes mit sich und mit Gott im Reinen sei. Das jedoch war sein Vater ganz gewiss nicht gewesen. Er war mit Schuld und Sorgen von dieser Welt geschieden, und es war ihm, seinem Sohn, nicht gelungen, ihm dieses Gefühl zu nehmen.
Sein Blick glitt zurück zu den Schachfiguren. Seit dem Tod seines Vaters fühlte er sich leer und wie betäubt. Das
Weitere Kostenlose Bücher