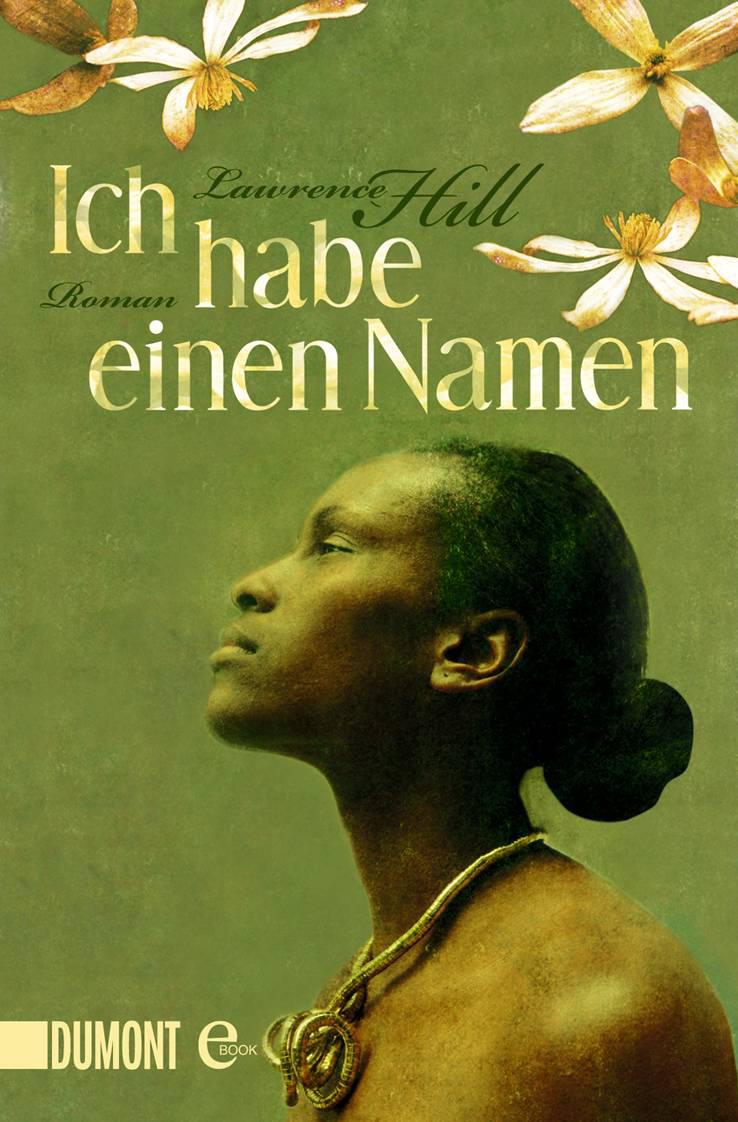![Ich habe einen Namen: Roman]()
Ich habe einen Namen: Roman
machen«, sagte ich.
»Niemals«, sagte Fanta.
»Sie bekommt bald ein
Baby«, sagte ich.
»Wann Baby?«, fragte
er.
»In einem Mond«, sagte
ich.
Der Toubab zögerte. Ich
konnte ihn atmen hören. Es war ein pfeifendes, keuchendes Geräusch. Ich fragte
mich, ob seine kleinen Nasenlöcher verstopft waren. Sein Mund war voller
schwarzer Zähne, und ich erhaschte einen Blick auf sein Zahnfleisch. Es war so
leuchtend rot wie der Kehllappen eines Truthahns. Er war ein hässlicher Mann,
der von innen heraus zu verfaulen schien. Böse Absichten sah ich in seinen
Augen jedoch nicht. Ich versuchte es noch einmal.
»Baby in einem Mond«,
wiederholte ich und fuhr mit der Hand über Fantas dicken Bauch. »Große Mama.
Große Mama. Sie sagt, ihr wollt sie essen.«
Der Toubab verstand
nicht. Der Helfer erklärte es ihm.
»Wir essen keine
Mutter«, sagte der Toubab. Er und der Helfer hielten sich die Bäuche vor
Lachen. »Arbeiten. Arbeiten im Toubabu-Land. Nicht essen.« Der Mann mit dem
orangefarbenen Haar ließ die Hände sinken. Die Untersuchung war vorüber.
Der Helfer meldete sich
wieder zu Wort. »Er wird sie nicht kochen. Sie wird für die Toubabu arbeiten.
Ihr werdet alle arbeiten.«
Ich konnte nicht
glauben, dass die Toubabu all diese Umstände auf sich nahmen, damit wir in
ihrem Land arbeiteten. Sie mussten das Schiff bauen, das wütende Wasser
überwinden, all diese Menschen und Güter verladen – nur damit wir für sie
arbeiteten? Sie konnten doch sicher selbst ihre Mangos pflücken und ihre Hirse
mahlen. Das war doch bestimmt viel einfacher als das alles hier!
Ich deutete auf den
Toubab und fragte den Helfer: »Was macht er?«
»Er ist der
Medizinmann«, sagte der Helfer.
»Du redest zu viel mit
ihnen«, sagte Fanta.
»Er sagt, er wird dich
nicht essen«, sagte ich.
»Wer sagt das?«
»Der Toubab.«
»Was hat er gesagt?«
»Dass du arbeiten
musst.«
»Warum sollte ich
arbeiten, wenn sie mich sowieso essen? Hör zu, Kind. Wir werden alle gekocht
und gegessen.«
Andere Toubabu brachten
Fanta weg. Ich musste bei dem Medizinmann bleiben, um den Fulbe-Gefangenen zu
erklären, was der Helfer sagte. Einer nach dem anderen wurden sie nach unten
geschickt. Als ich die letzte Gefangene auf dem Schiffsdeck war, verließ mich
der Mut. Die Toubabu hatten mich benutzt, und jetzt würden sie mich töten. Fast
wäre ich auf die Knie gefallen, aber ich dachte an meine Mutter und meinen
Vater vor unserem Dorf und blieb stehen. Warmer Urin rann mir am Bein herunter,
und ich glühte vor Scham.
Der Medizinmann gab mir
eine Kalebasse mit Wasser. »Du hilfst mir«, sagte er.
Ich trank, sagte aber
nichts.
»Du hilfst mir, und ich
helfe dir.«
Ich hatte keine Ahnung,
wie er mir helfen wollte und was ich für ihn tun konnte. Ich wünschte, sie
hätten mich mit Sanu und Fanta weggeschickt. Ich sah, wie die Heimatländer das
Schiff verließen. Sie kletterten in ihre Kanus und ruderten davon. Sie durften
kommen und gehen, aber wir, die Gefangenen, würden von hier weggebracht werden.
Dessen war ich sicher.
Die Hand des
Medizinmannes lag auf meiner Schulter. Er sagte etwas, das ich nicht verstand.
Der Helfer erklärte mir, dass ich mit ihm hinunter ins Schiff gehen solle. Er
ging voran. Der Medizinmann packte meinen Arm und führte mich steile Stufen
hinunter in einen dunklen, stinkenden Raum. Der Geruch menschlicher
Ausscheidungen ließ mich würgen. Ich stellte mir den größten Löwen meines
Landes vor, so groß wie der Löwenberg an der Küste, aber lebendig, atmend und
hungrig. Mir schien, als würde ich direkt in seinen Hintern geführt. Der Löwe
hatte einige Dörfer verwüstet, die Menschen lebend verschlungen und bewahrte
sie aufgestapelt und kaum atmend im schwachen Licht seines Bauches auf. Der
Helfer hielt ein tragbares Feuer in die Höhe, das Licht in die Schatten warf.
Der Medizinmann hatte ebenfalls ein Feuer in einem Behälter. Wohin ich mich
auch wandte, sah ich nackte Männer liegen, auf Schlafbrettern
aneinandergekettet, stöhnend und weinend. Ausscheidungen und Blut flossen über
die Bodenbretter und bedeckten meine Zehen.
Unser Gang war nichts
als ein schmaler Pfad zwischen den Männern links und rechts. Eng wie Fische in
einem Eimer lagen sie auf drei Ebenen, die unterste knapp über meinen Füßen,
die mittlere bei meiner Hüfte und die obere auf Höhe meines Halses. Sie konnten
die Köpfe kaum weiter als ein, zwei Handbreit über die nassen hölzernen Latten
heben.
Die Männer konnten
nicht
Weitere Kostenlose Bücher