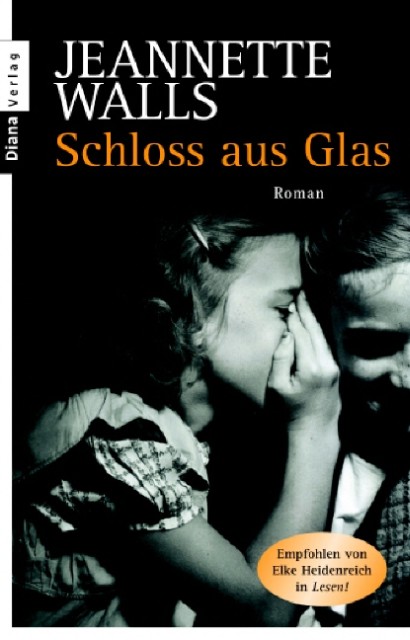![Schloss aus Glas]()
Schloss aus Glas
wundersame Verwandlung des Hauses Gestalt annahm.
Ich öffnete den Zwanziglitereimer draußen auf der Veranda und rührte das Öl, das sich oben abgesetzt hatte, in die butterblumengelbe Farbe ein, bis sie cremig war. Ich tunkte einen dicken Pinsel ein und strich damit in langen, gleichmäßigen Bewegungen über die alten Bretter der Holzverkleidung. Die Farbe war hell und glänzend und sah sogar noch besser aus, als ich gehofft hatte. Ich fing am hinteren Ende der Veranda an und arbeitete mich um die Tür herum, die in die Küche führte. Wenige Stunden später waren alle Flächen gelb, die ich von der Veranda aus erreichen konnte. Ein Teil der Vorderseite und die Flanken waren noch ungestrichen, aber ich hatte noch nicht mal ein Viertel der Farbe verbraucht. Wenn die anderen mithalfen, könnten wir auch die anderen Flächen streichen, an die ich nicht rangekommen war, und im Handumdrehen hätten wir ein fröhliches gelbes Haus.
Aber weder Mom noch Dad, noch Brian, noch Lori waren beeindruckt. »Dann ist jetzt also ein Teil der Vorderseite gelb«, sagte Lori. »Jetzt geht's wirklich aufwärts mit uns.«
Also musste ich die Arbeit allein zu Ende bringen. Ich versuchte mir eine Leiter aus Holzresten zu zimmern, aber sie
brach immer wieder zusammen, sobald ich sie belastete. Ich war noch damit beschäftigt, mir eine stabilere Leiter zu bauen, als es wenige Tage später zu einem Kälteeinbruch kam und meine Farbe im Eimer gefror. Als es wieder wärmer wurde und die Farbe auftaute, öffnete ich den Eimer. Durch den Frost hatten sich die Bestandteile getrennt, und die einst geschmeidige Flüssigkeit war jetzt klumpig und wässrig wie geronnene Milch. Ich rührte sie, so fest ich konnte, und auch als ich längst wusste, dass die Farbe hinüber war, rührte ich noch weiter, weil ich ebenfalls wusste, dass wir nie im Leben neue Farbe bekommen würden und dass wir jetzt statt eines frisch gestrichenen gelben Hauses oder auch nur eines schäbigen grauen Hauses ein verrückt aussehendes Flickwerk hatten - ein Haus, dem jeder ansehen konnte, dass die Bewohner es verschönern wollten, aber nicht genug Biss hatten, um die Arbeit zu Ende zu bringen.
Die Little Hobart Street führte in eine Senke, die so tief und schmal war, dass die Leute scherzten, man müsse das Sonnenlicht hineinpumpen. In der Nachbarschaft lebten viele Kinder - Maureen hatte zum ersten Mal richtige Freundinnen -, und wir alle trafen uns meistens am Exerzierplatz der Nationalgarde unten am Fuß des Berges. Die Jungs spielten dort Football, die meisten Mädchen in meinem Alter hockten den ganzen Nachmittag auf der Backsteinmauer um den Exerzierplatz herum, kämmten sich die Haare, frischten ihr Lipgloss auf und reagierten gespielt entrüstet, wenn ein Reservist mit Bürstenschnitt ihnen zupfiff, obwohl sie sich insgeheim darüber freuten. Eins von den Mädchen, Cindy Thompson, legte sich richtig ins Zeug, meine Freundin zu werden, aber dann stellte sich heraus, dass sie mich in Wirklichkeit nur für die Jugendgruppe des Ku-Klux-Klan gewinnen wollte. Da ich weder Makeup trug noch besonders wild darauf war, mir ein Bettlaken überzustülpen, spielte ich Football mit den Jungs, die von ihrer Keine-Mädchen-Regel abwichen und mich mitmachen ließen, wenn Not am Mann war.
Die wohlhabenderen Leute von Welch suchten sich nicht gerade unser Viertel zum Wohnen aus. Auf unserer Straße wohnten ein paar Bergleute, aber die meisten Erwachsenen waren arbeitslos. Einige von den Müttern hatten keinen Mann und einige von den Vätern eine kaputte Lunge. Die Übrigen hatten entweder zu große Probleme oder einfach keine Lust, und so lebten praktisch alle widerwillig von irgendeiner Form staatlicher Unterstützung. Wir waren zwar die ärmste Familie auf der Little Hobart Street, doch Mom und Dad beantragten weder Sozialhilfe noch Essensmarken,
und sie lehnten auch milde Gaben ab. Wenn sie uns in der Schule Säcke mit Anziehsachen aus der Altkleidersammlung mit nach Hause gaben, bestand Mom darauf, dass wir sie zurückbrachten. Wir kommen schon allein zurecht, sagten Mom und Dad dann. Wir nehmen keine Almosen, von niemandem.
Wenn es richtig knapp wurde, rief Mom uns in Erinnerung, dass einige von den anderen Kindern in unserer Straße noch schlechter dran waren als wir. Die zwölf Grady-Kinder hatten keinen Dad - er war entweder bei einem Grubenunglück ums Leben gekommen, oder er hatte sich mit einem Flittchen aus dem Staub gemacht, je nachdem, wem man glaubte -, und ihre
Weitere Kostenlose Bücher