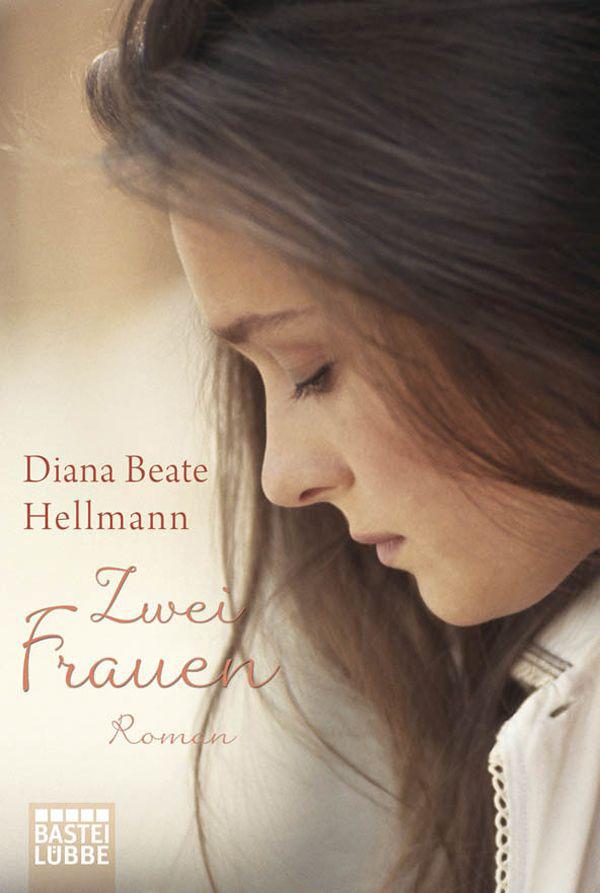![Zwei Frauen: Roman (German Edition)]()
Zwei Frauen: Roman (German Edition)
meinte:
»Gehen Sie! Zur Chirurgie! Immer geradeaus!«
Der Behandlungsraum in der Chirurgie unterschied sich nur insofern von denen, die ich bereits gesehen hatte, als dass er düsterer, unordentlicher und übelriechender war. Eine mürrische Krankenschwester brummelte mir zu, ich möchte meinen linken Arm freimachen, auf der Liege Platz nehmen und warten.
Nach etwa zehn Minuten stürzte ein Arzt herein. Er war noch sehr jung und ausgesprochen attraktiv.
»Morgen!«, keuchte er, hechtete zu einem hoffnungslos überladenen Schreibtisch und grabschte scheinbar wahllos nach einer Krankenakte.
»Sind Sie das?«, fragte er mich dann.
»Wer?«
»Eva Martin?«
»Ja.«
»Prima!«
Sein Name war so schwierig, dass ich allenfalls hätte versuchen können, ihn auf dem Klavier zu spielen. Da er mich aber mit kaum noch zu überbietender Ausdauer zur Ader ließ, fand ich bald einen Künstlernamen für ihn: der Blutsauger!
Nach dem zehnten Röhrchen stöhnte ich laut auf. »Wozu brauchen Sie denn das ganze Blut?«
»Das schicken wir in die Dritte Welt!«
So viel Ehrlichkeit frappierte mich, doch schon im nächsten Moment winkte er lachend ab. »Das war natürlich ein Scherz!«, meinte er.
»Natürlich. Und wozu brauchen Sie das Blut dann wirklich?«
»Oh«, seufzte er, »für den Hämoglobinwert, für die Erythrozyten, die Leukozyten, den mch, das mcv, die mchc, die Thrombozyten, die Retikulozyten und so weiter.«
Er hatte sehr schnell und so beiläufig gesprochen, dass ich mir in meiner medizinischen Unbelecktheit regelrecht dämlich vorkam. Ich sagte rasch »Ach so!«, und hoffte inständig, das möchte einen einigermaßen intelligenten Eindruck machen. Ich hatte Glück. Mein Blutsauger war dermaßen beeindruckt, dass er sich trotz seiner Promotion herabließ, mich in ein Gespräch zu verwickeln.
»Sind Sie schon lange hier?«, wollte er wissen.
»Seit Freitag!«, antwortete ich.
»Was fehlt Ihnen denn?«
»Ich habe Knoten in den Leistenbeugen und die –«
»Dürfte ich mir das mal ansehen?«
»Sicher!«
Nach den beiden Lasers und dem Aufnahmearzt konnte mich nichts mehr schrecken. So zog ich bereitwillig meine Hose ein Stück herunter, damit der Herr Blutsauger in Ruhe werkeln konnte. Er ging dabei auch nicht zartfühlender vor als seine Kollegen, wohl aber wesentlich weniger routiniert, und als er fertig war, wirkte er gar unwissender als zuvor.
»Na«, fragte ich, »was meinen Sie?«
»Schwer zu sagen!«, murmelte er. »Vielleicht eine Hyperplasie. Oder eine Lymphadenitis. Es könnten aber auch Lymphosarkome sein. Oder eine Lymphogranulomatose. Oder Retikulosen. Schwer zu sagen.«
Davon war ich überzeugt, denn es war offenbar nicht nur schwer zu sagen, sondern darüber hinaus auch sehr schwer auszusprechen.
Dennoch wollte ich mich so schnell nicht entmutigen lassen, bildete ich mir doch ein, auch aus dem finstersten Fachlatein müsste ein Weg ins umgangssprachliche Licht führen.
»Was ist das denn?«, fragte ich deshalb.
»Retikulosen?«, vergewisserte er sich. »Das sind irreversible Proliferationen von Zellen des retikulo-endothelialen Systems.«
Er verheimlichte mir nichts, und ich zeigte mich dankbar und vor allem gelehrig! »Ach so!« Mehr fiel mir nicht ein, und ich zog meine Hose wieder hoch, hockte mich auf die Liege und harrte der Dinge, die da kommen sollten – aber es kam nichts. Die Krankenschwester klapperte nach wie vor mit den Reagenzgläsern, und mein Blutsauger war vollauf damit beschäftigt, die Ausbeute meiner Venen mit Etiketten zu versehen. Mich beachtete man gar nicht mehr. Ostentativ räusperte ich mich, worauf er mich verständnislos ansah. Erst nach mehrmaligem Nachfragen schickte er mich zum » KE «, zum Röntgen ins Erdgeschoss.
Draußen auf dem Gang war es wie in einem Taubenschlag. Die umherschwirrenden Ärzte, Schwestern und Patienten schienen über persönliche Einflugschneisen zu verfügen, und wenn man nicht Acht gab, konnte das leicht zu unangenehmen Kollisionen führen. Das war aber nicht der einzige Gefahrenherd. Das Treppenhaus nämlich stammte eindeutig aus der Vorkriegszeit, die Stufen waren ungleichmäßig hoch und ausgetreten, an den Wänden fehlte der Putz, und streckenweise war das Holzgeländer brüchig.
So viel architektonische Morbosität ließ auf einen sorgfältig erdachten Plan der Klinikverwaltung schließen, die diesen Ort offenbar zum Zulieferbetrieb für die Orthopädie erklärt hatte. Entsprechend vorsichtig wagte ich den Abstieg ins
Weitere Kostenlose Bücher