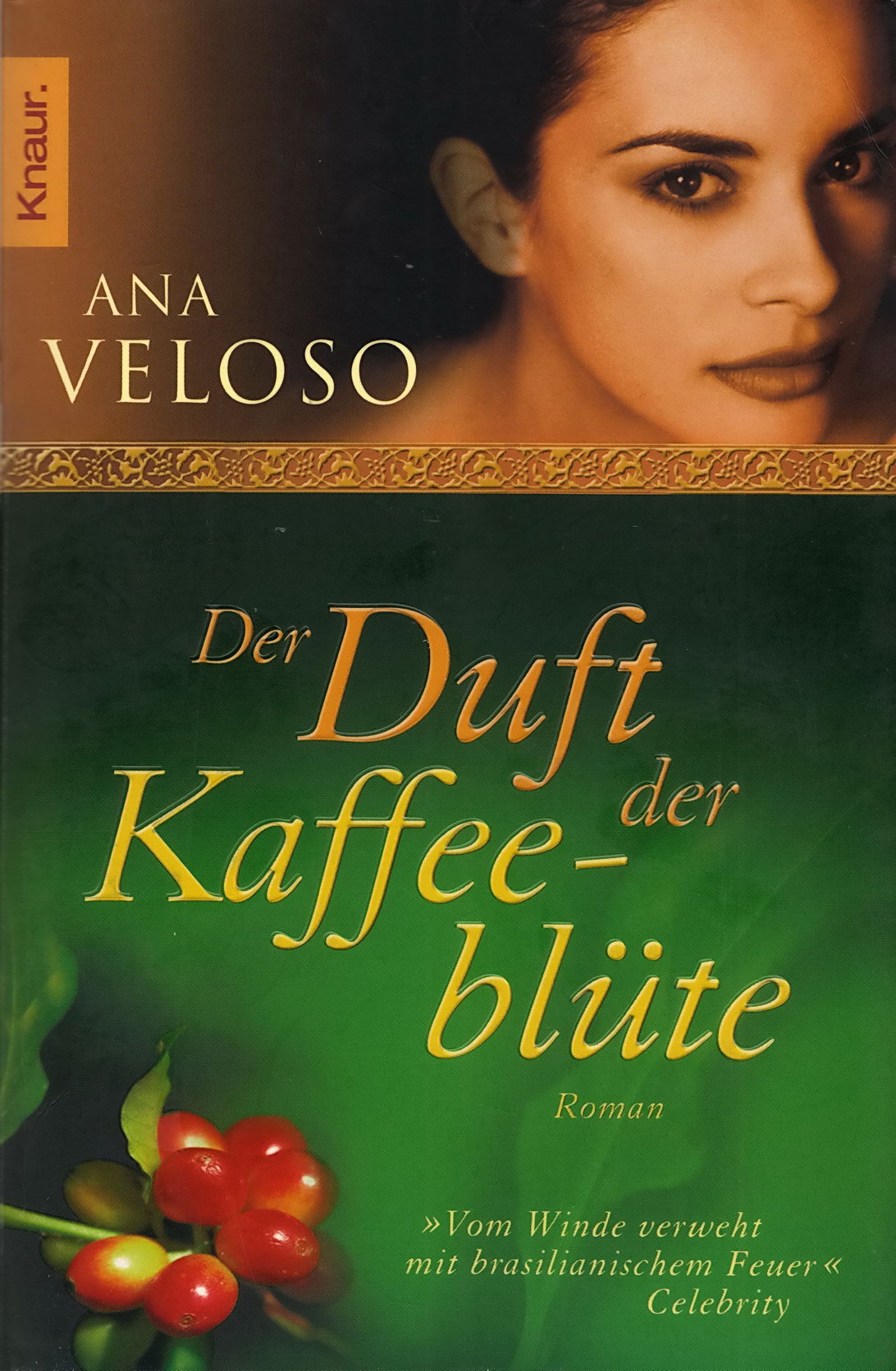![Ana Veloso]()
Ana Veloso
auszuruhen. Man sah schwarze amas mit weißen Kindern,
Gruppen schwarz gekleideter Witwen, die streng die jungen Leute musterten, die
vorbeispazierten, und Senhores mit geschäftiger Miene, die es eilig zu haben
schienen.
»Wie hübsch das ist!«, rief Aaron.
»Ja, nicht wahr?« Pedros Augen nahmen einen wehmütigen
Ausdruck an. Wie konnte er nur vergessen, wie beschaulich und friedlich es hier
war? Warum nur hatte er dieses Idyll freiwillig gegen den Moloch Rio
eingetauscht? Als in diesem Moment ein Herr auf der Straße seinen Hut hob und
Pedro mit einer leichten Verbeugung grüßte, fiel es ihm wieder ein. Rubem
Leite, der Notar, hatte ihn sofort erkannt. Und alle anderen Wichtigtuer würden
ihn ebenfalls sofort erkennen. Sie würden ihm schmeicheln, ihn belästigen, ihn
um ein Darlehen bitten oder ihn von unsinnigen geschäftlichen Transaktionen zu überzeugen
versuchen. Ihn, den jungen Herrn von Boavista, der in ihren Augen doch nur ein
verwöhnter Nhonhô war. Ihn, dessen erste Gehversuche sie miterlebt hatten, an
dessen Geheul sie sich erinnerten, als er einmal seine ama verloren
hatte, und dessen Jugendsünden ihnen noch heute Anlass zur Belustigung gaben.
Sie glaubten Pedro da Silva zu kennen, doch er
war ein anderer geworden. In der Anonymität der Großstadt konnte er niemanden
mit seinem Namen beeindrucken, da galt es, mit anderen Qualitäten zu glänzen.
Hier in der Provinz würde so schnell niemand Notiz von seinen Talenten nehmen.
Für die Bewohner des Vale wäre er für immer der Sohn von Eduardo da Silva, ein
verzogenes Söhnchen. Was für eine Bürde war doch diese kollektive Erinnerung!
Wahrscheinlich würde ihn die Witwe Fonseca für den Rest seines Lebens erstaunt
ansehen und feststellen, wie groß er doch geworden sei. Und wahrscheinlich wäre
sein alter Lehrer ähnlich überrascht, dass sein kleiner Pedro, der als Kind
einen extremen Widerwillen gegen die schöngeistigen Fächer gezeigt hatte, heute
freiwillig ins Theater ging oder ein Buch zur Hand nahm.
Die Kutsche verließ die Stadtgrenzen. Die
Pflasterstraße wurde durch einen Lehmweg abgelöst, das Gefährt rollte nun etwas
leiser hinter den beiden Pferden her. Die Sonne stand schon tief am Himmel. Über
den Feldern summte und surrte es, doch Pedro, João Henrique und Aaron blieben
dank des Fahrtwindes von Mücken, marimbondos und anderen Insekten
verschont. Es duftete schwach nach Kaffeeblüten. Die Kutsche fuhr an einer
Gruppe von Sklaven vorbei, die sich auf dem Rückweg von den Feldern befand. Sie
trugen Körbe auf dem Kopf und sangen.
»Die tragen ja gar keine Ketten an den Füßen«,
wunderte sich Aaron.
»Natürlich nicht. Mit wunden Knöcheln können sie
nicht arbeiten.«
»Aber ich dachte ...«
»Ja«, unterbrach ihn Pedro, »du hast zu viele
von Leóns Schmähartikeln gelesen. Die Sklaven werden hier gut behandelt. Die
wenigsten von ihnen würden fliehen – sie kennen doch die Freiheit gar nicht,
und sie wüssten auch nichts damit anzufangen.«
»Warum ist dann die Zeitung voll von Annoncen,
in denen entlaufene Schwarze gesucht werden?«
»Es leben allein in der Provinz Rio de Janeiro
hunderttausende von Sklaven. Wenn davon zehn am Tag weglaufen, ist das nur ein
verschwindend geringer Anteil. Samstags stehen dann vielleicht fünfzig
Suchanzeigen in der Zeitung – das sieht nach viel aus, ist es aber nicht.«
Aaron schien mit dieser Rechnung nicht
einverstanden zu sein, ließ das Thema aber fallen.
»Weißt du«, meldete sich João Henrique zu Wort, »wie
viele von den entlaufenen Negern man ausfindig macht?«
»Nein«, antwortete Pedro. »Ich schätze, nicht
viele. Die Beschreibungen treffen auf zu viele von ihnen zu. Ich meine, wenn in
der Anzeige steht: > von mittelgroßer Statur, etwa dreißig Jahre alt, hört
auf den Namen Jose < , dann stehen die Chancen wohl eher schlecht, den Mann zu
finden. Anders ist es, wenn der Flüchtling besondere Kennzeichen hat, auffällige
Narben, Missbildungen oder Ähnliches. Ich denke, dass diese Leute schnell
gefunden werden.«
»Mir tun sie Leid«, sagte Aaron. »Wenn jemand so
viel riskiert, so viele Entbehrungen auf sich nimmt und bewusst eine halbwegs
erträgliche Gegenwart gegen eine nicht eben rosige Zukunft eintauscht, dann
muss ihm doch sehr an seiner Freiheit gelegen sein. Und wenn sie mutig und
schlau genug sind, zu entwischen, dann bringen diese Leute ja schon die
wichtigsten Eigenschaften mit, die man als freier Mensch braucht – und haben
sich ihre Freiheit
Weitere Kostenlose Bücher