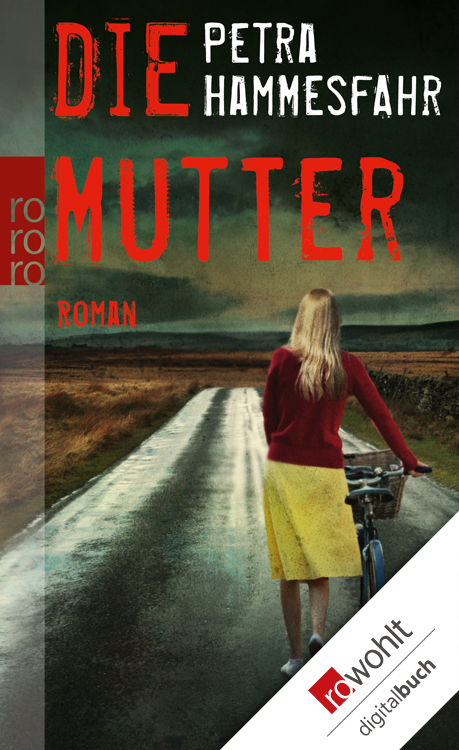![Die Mutter]()
Die Mutter
von Sicherheit, das ich mit Udo von Wirth auf dem Krankenhausplatz empfunden hatte. Ich sah es nicht nur, ich hörte es auch mit Olgerts Stimme, die Sätze aus Renas Tagebuch zitierte. «Sie tut mir so furchtbar Leid!»
Nita war krank. Sie war gegangen, um zu sterben. Sie wollte nicht, dass ihre Mutter ihr dabei zuschaute. «Das tut sie mir nicht an.» Das war die Antwort. Nita Kolter liebte ihre Mutter und wollte sie nicht leiden sehen. Nur zwei gute Freunde als Begleitung auf dem letzten Weg. Und eine hatte vielleicht nicht ganz freiwillig mitkommen wollen. Aber das war nicht mehr so wichtig.
Wenn ich mich entschließen konnte, nur einen Bruchteil von dem zu glauben, was Regina Kolter gesagt hatte, nahm das Bild eine andere Farbe an. Es wurde klarer, die Konturen schärfer und zugleich lieblicher. Es gab noch viele verwischte Stellen. Ein besoffener Autofahrer und ein hirnamputierter Arzt? Ich hatte noch nie von Unfallverletzungen gehört, die erst Jahre später gravierende Folgen zeigten. Rena hatte auch nie erwähnt, dass Nita in irgendeinerWeise beeinträchtigt wäre. Aber Rena hatte vieles nicht erwähnt. Und ich hatte nicht genug medizinisches Wissen zusammengetragen, um mir ein Urteil erlauben zu können.
Ich erinnerte mich an ihr Schwanken vor unserer Haustür, an Menkes Arm um ihre Taille. Man konnte es sehen wie Jürgen oder wie Regina Kolter. Bekifft oder geschwächt. Wenn ich mich für Letzteres entschied, gab es für alles eine Erklärung. Sogar für den Satz, den Nita der Frankfurter Polizei auf Band gesprochen hatte.
Natürlich war es Hoffnung. Mehr noch, Gewissheit. Rena kommt zurück, irgendwann kommt sie zurück. Mit dieser Gewissheit war ein Besuch bei Uwe Lengries überflüssig. Aber ich hatte mich entschlossen, systematisch vorzugehen und dem polizeilichen Beispiel zu folgen. Man gibt sich nicht zufrieden mit der Aussage einer Mutter, die nur sieht, was sie sehen will. Man hört sich auch an, wie andere die Sache sehen. Vielleicht erkennt man dabei die Ursache für den Denkfehler, der der Polizei unterlaufen ist.
Um halb zwölf fuhr ich zum ersten Mal an der Cityreinigung vorbei. Es gab keinen freien Parkplatz in der näheren Umgebung. Ich fühlte mich zwar stärker als in der Nacht, aber nicht stark genug, mir Klinkhammers Frechheit herauszunehmen und in der zweiten Reihe zu parken. Eine Runde um den Block und noch eine, dann fand sich ein freies Plätzchen. Nicht lang genug, um den Mercedes ordnungsgemäß darauf abzustellen. Er ragte mit dem Heck in die Straße. Es war mir egal.
Nicht egal war mir, dass wieder keine Reaktion erfolgte, nachdem ich auf den Klingelknopf gedrückt hatte. Ich drückte zwei andere Knöpfe, es knackte in der Gegensprechanlage. Ein metallisches «Ja?» war zu hören. Der Stimme nach eine ältere Frau.
«Ich möchte zu Lengries», sagte ich. «Da öffnet niemand. Würden Sie bitte aufdrücken? Dann kann ich eine Nachricht an die Wohnungstür heften. Es ist wichtig.»
Es summte im Türschloss, zwei Sekunden später stand ich in einem gefliesten Treppenhaus. Dass ich im zweiten Stock erwartetwurde, sah ich schon auf dem ersten Treppenabsatz. Die Stimme hatte nicht getrogen, eine Frau Anfang sechzig. Sie lugte über das Geländer, verfolgte meinen Aufstieg. Ich zog Notizbuch und Kugelschreiber aus der Handtasche.
Als ich den zweiten Stock erreichte, zeigte die Frau auf eine der Wohnungstüren und sagte: «Die sind in Urlaub. Aber der Junge ist da. Nur wenn er Musik hört, hört er die Klingel nicht. Da muss man schon tüchtig an die Tür klopfen.»
Ich wollte klopfen, da sagte sie: «Jetzt ist er nicht da. Er ist vor einer Stunde runtergegangen. In die Garage, nehme ich an. Fummelt wohl wieder am Auto. Was anderes haben die ja nicht im Kopf, nur Musik und Autos. Gehen Sie runter bis in den Keller und dann die Tür gegenüber der Treppe. Da geht’s in die Garage.»
Ich erkannte ihn sofort, als ich ihn sah. Uwe Lengries hatte sich auf unserem Hof umgedreht, als Nita ihre Show abzog. Er kniete auf der Rückbank in seinem Wagen und hantierte an zwei Lautsprechern auf der Heckablage.
Er erkannte mich ebenfalls und sein Gesicht verzog sich in Ablehnung. Er wollte nicht mit mir reden. Nicht über Nita, nicht über André Menke, nicht über Rena und nicht über das, was er Klinkhammer und Olgert erzählt hatte. «Fragen Sie die. Ich hab keine Lust, es noch dreimal durchzukauen.»
Dann begann er doch, stockend, widerwillig und mühsam gegen die Tränen ankämpfend.
Weitere Kostenlose Bücher