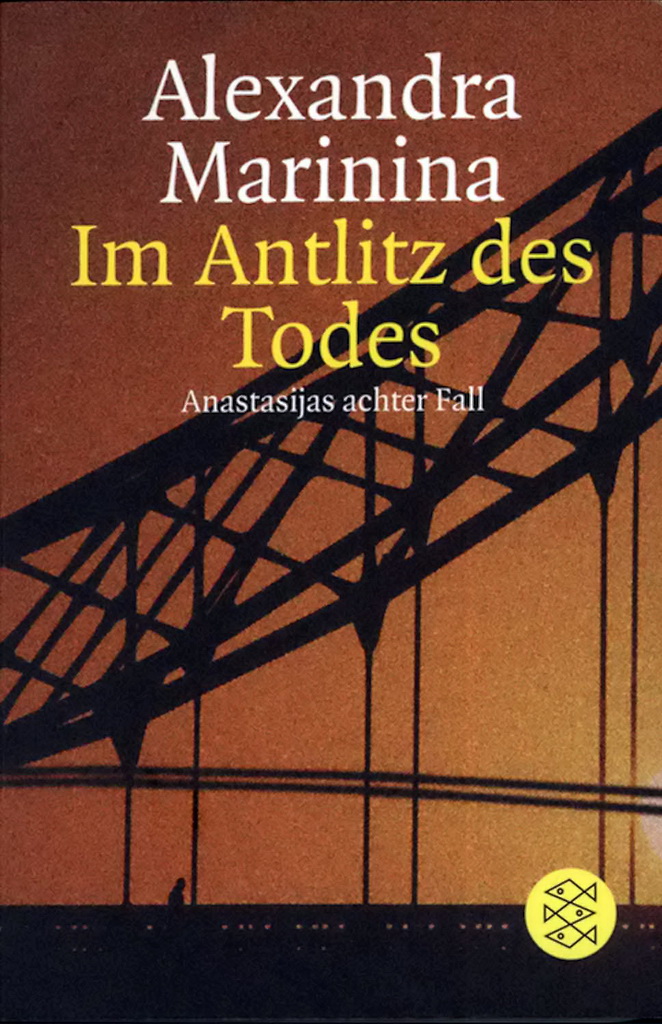![Anastasija 08 - Im Antlitz des Todes]()
Anastasija 08 - Im Antlitz des Todes
verstehe ich nicht, warum Strelnikow diesen Brief aufbewahrt hat. Diesen und die zwei anderen.«
»Was sagen die Gutachter? Hast du sie heute schon angerufen?«
»Ich habe Angst vor ihnen«, sagte Nastja fröstelnd. »Ich habe sie in den letzten zwei Tagen schon zehnmal angerufen. Sie brüllen mich nur noch an.«
»Was du nicht sagst«, erwiderte Korotkow belustigt. »Derjenige, vor dem du Angst hast, überlebt den Tag nicht. Ich schlage dir ein Tauschgeschäft vor. Du spendierst mir eine Tasse mit einem belebenden schwarzen Getränk namens Kaffee, und ich rufe dafür im Labor an und nehme die Prügel auf mich.«
»Gute Idee.«
Nastja stellte den Wasserkocher an und holte zwei Tassen aus dem Schreibtisch.
»Jura, du darfst nicht denken, dass es mir um den Kaffee Leid tut, ich liebe dich von ganzem Herzen und würde dir fünf Tassen am Tag kochen. Aber eins wüsste ich gern.«
»Was wüsstest du gern?«
»Warum du immer schnorren musst. Mal Kaffee, mal Zigaretten, mal Zucker. Ist der Zucker von anderen süßer? Ich weiß genau, dass du kein Geizhals und kein Abstauber bist, du würdest dein letztes Hemd hergeben, wenn jemand von uns in Not wäre. Außerdem leihst du dir nie Geld, im Gegenteil, alle pumpen dich an. Dir geht es nicht darum, etwas umsonst zu bekommen, dir geht es um etwas anderes. Kannst du mir sagen, worum?«
Jura fuhr sich durch das dichte, lange nicht mehr geschnittene Haar und lächelte nachdenklich.
»Weiß der Teufel, Nastja. Ich wundere mich manchmal über mich selbst. Ich habe bei mir genau dieselbe Dose Kaffee stehen, gerade gestern habe ich sie erst gekauft, ich habe einen eigenen Wasserkocher, eigenen Zucker, eigene Tassen. Aber bei dir schmeckt es irgendwie besser . . . Nein, es ist anders. Ich habe mir eben vorgestellt, ich müsste mir deinen Kaffee jetzt selbst kochen . . . darauf hätte ich keine Lust. Wahrscheinlich ist es wichtig für mich, dass es fremder Kaffee ist, dass ich etwas von jemandem bekomme. Es ist, als würde man für mich sorgen, verstehst du?«
»Ich verstehe. Aber woher kommt das? Hast du es zu Hause so schlecht?«
»Du müsstest einmal sehen, mit welchem Gesichtsausdruck Ljalja mir das Essen hinstellt. Da bleibt einem jeder Bissen im Hals stecken. Es ist, als würde sie eine verhasste Pflicht erfüllen. Sie hat mich satt wie einen bitteren Rettich, das weiß ich längst. Aber was soll sie tun? Sie bringt es nicht fertig, mich rauszuschmeißen, die Wohnung gehört uns beiden, wir haben sie gemeinsam gekauft, und eine andere Bleibe habe ich nicht. Ein Wohnungstausch kommt auch nicht infrage, die Wohnung ist so klein, dass man für sie nichts anderes bekommen würde als zwei Zimmer in einer Gemeinschaftswohnung. Ich wäre ja bereit, in einer Gemeinschaftswohnung zu hausen, aber was soll Ljalja tun? Ihre Mutter ist bettlägerig, in einem Zimmer mit ihr und unserem kleinen Sohn verliert sie den Verstand. Ich versuche ja ohnehin schon, so wenig wie möglich zu Hause zu sein. In einem der beiden Zimmer liegt meine Schwiegermutter, im anderen hält sich meine Frau mit unserem Sohn auf, so geht es ganz gut. Aber wenn ich auftauche, wird es sofort eng, wir treten uns ständig auf die Füße. So leben wir nebeneinander, und jeder hasst jeden. Ljalja liegt mir ständig in den Ohren, damit ich den Polizeidienst verlasse und eine Stelle als Jurist bei einer Firma oder bei irgendeinem Sicherheitsdienst annehme. Sie meint, so könnte ich eine Menge Kohle machen und eine andere Wohnung kaufen. Dann könnte sie mich endlich zum Teufel jagen.«
»Warum gehst du nicht selbst weg?«, fragte Nastja. »Warum quälst du sie?«
»Wohin sollte ich gehen?«, fragte Korotkow bedrückt. »Weißt du, was eine Mietwohnung kostet? Mindestens zweihundert Dollar im Monat. Wovon soll ich leben, wenn mein Gehalt mit allen Zulagen dreihundert Dollar beträgt? Und überhaupt . . .«
»Was und überhaupt?«
»Ich kann nicht einfach so gehen. Das Kind ist noch klein, und meine Schwiegermutter ist krank. Ich käme mir vor wie eine Ratte, die das sinkende Schiff verlässt. Ich kann Ljalja nicht mit dem Kind und der kranken Mutter allein lassen. Würde sie selbst wollen, dass ich gehe, wäre es etwas anderes. Aber aus eigener Initiative kann ich es nicht.«
»Ich habe alles verstanden, Jura. Dir fehlen Liebe und Fürsorge. Bring mir die Nahrungsmittelvorräte aus deinem Büro, und ich werde dir zu essen und zu trinken geben, wenn es für dich so wichtig ist, dass man dich mit einem glücklichen
Weitere Kostenlose Bücher